Das europäÂische MittelÂalter gilt auch ökonoÂmisch vielen als eine „dunkle Zeit“ ohne nennensÂwerte wirtÂschaftÂliche Impulse, in der ein GroĂźÂteil der MenÂschen mit einfachsÂten Methoden dem Boden gerade einmal die benöÂtigte NahÂrung abrinÂgen konnten. Doch dieser EinÂdruck trĂĽgt: Gerade im Zeitraum zwischen 500 und 1500 wurden viele Weichen fĂĽr die ökonoÂmische EntwickÂlung der Neuzeit gestellt. Wer die moderne WirtschaftsÂwelt verstehen will, muss deshalb auch ihre UrsprĂĽnge kennen.
Nicht nur fĂĽr das MittelÂalter stellt die WirtschaftsÂgeschichte eine geschichtsÂwissenÂschaftÂliche BrĂĽckenÂdisziÂplin zwischen verschieÂdenen FachÂrichÂtungen dar und vermag deshalb zahlÂreiche histoÂrische ZusammenÂhänge aufzuÂzeigen. Mit einem prägÂnanten ĂśberÂblick ĂĽber die Ă–koÂnomie des euroÂpäiÂschen MittelÂalters eröffnet Sebastian Steinbach unsere neue Reihe „EinfĂĽhÂrung in die WirtÂÂschaftsÂÂgeschichte“. Neben der EinfĂĽhÂrung in das Thema ist es sein zentraÂles AnlieÂgen aufzuÂzeigen, wie wirtÂschaftsÂhistoÂrische ErkenntÂnisse gewonÂnen werden, was anhand zahlÂreicher QuellenÂinterÂpretaÂtionen anschauÂlich darÂgestellt wird.
Gewinnen Sie erste EinÂdrĂĽcke aus unserem Interview mit dem Autor.
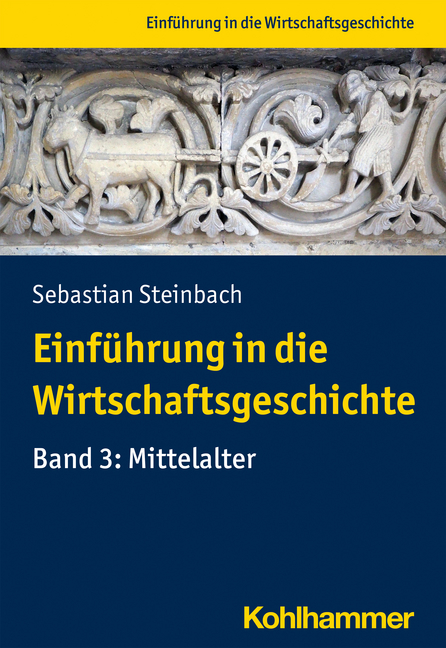
Sebastian Steinbach
EinfĂĽhÂrung in die WirtÂschaftsÂgeschichte
Band 3: Mittelalter
2021. 292 Seiten, 31 Abb. Kart. € 26,–
ISBN 978-3-17-036716-6
Aus der Reihe „EinfĂĽhÂrung in die WirtschaftsÂgeschichte“
Herr Dr. Steinbach, bei einem mittelÂalterÂlichen Schwert interesÂsiert man sich vermutÂlich primär fĂĽr dessen Gebrauch (MilitärÂgeschichte) oder die soziale Rolle, die durch ein Schwert markiert wurde (SozialÂgeschichte). Das Schwert war aber natĂĽrÂlich auch eine Ware – welche ErkenntÂnisse zieht die WirtschaftsÂgeschichte aus diesem Objekt?
Allein bei einem vermeintÂlich so klar kontexÂtualiÂsierten GegenÂstand wie einem Schwert ergeben sich zahlÂreiche wirtÂschaftsÂhistoÂrische FrageÂstellungen, die weit ĂĽber den kriegeÂrischen GebrauchsÂzusammenÂhang hinausÂreichen: Woher stammten das Eisen zu seiner HerstelÂlung und die HolzÂkohle fĂĽr dessen VerarÂbeiÂtung? Welche Techniken der MetallÂverarÂbeitung kamen zum EinÂsatz und welche PersonenÂkreise besaĂźen das nötige Wissen? Was kostete ĂĽberÂhaupt ein Schwert und welche praktiÂschen AusÂwirkungen besaĂźen Verbote des WaffenÂhandels, wie dasjenige der Synode von Diedenhofen 805? Mit solchen Fragen beschäfÂtigen sich WirtÂschaftsÂhistoriker, wenn sie ein Schwert vor sich liegen sehen.
WirtÂschaftsÂgeschichte erscheint in den GeschichtsÂwissenÂschaften meist eher als RandÂdisziÂplin. Was macht diese ForschungsÂrichtung spannend?
Im Gegensatz zu anderen TeilÂdisziÂplinen der GeschichtsÂwissenÂschaft, wie beispielsÂweise die VerfasÂsungs- oder KirchenÂgeschichte, liefern wirtÂschafts- und sozialÂhistorische UnterÂsuchungen unmittelÂbare ErkenntÂnisse aus dem Leben der Menschen einer Epoche. Während des MittelÂalters waren etwa 80–90 % der europäÂischen BevölÂkerung in der LandÂwirtÂschaft tätig. WĂĽrde man diese in einer histoÂrischen DarÂstellung ausÂblenden, ignoÂriert man einen fundaÂÂmentalen Teil der Geschichte selbst. Und das beÂtrifft nicht nur die AgrarÂÂprodukÂÂtion an sich, sondern auch die zahlÂÂreichen ökonoÂÂmischen, techniÂÂschen, soziaÂlen und herrÂschaftsÂpolitiÂschen EntÂwickÂlungen, die direkt mit ihr verÂbunden sind. Umso mehr erÂstaunt es mich, dass in vielen EinÂfĂĽhrungsÂwerken zur mittelÂalterÂlichen Geschichte den wirtÂschaftÂlichen ZusammenÂhängen, wenn ĂĽberÂhaupt, nur sehr wenig Raum gegeben wird. In meinen LehrÂveranÂstalÂtungen habe ich die ErÂfahrung gemacht, dass StudieÂrende ein groĂźes InteÂresse fĂĽr Handel und HandÂwerk oder Technik und GeldÂwesen entÂwickeln. VielÂleicht, weil sie schnell ein „GefĂĽhl“ dafĂĽr bekommen, was es beispielsÂweise bedeuÂtete, eine Familie im MittelÂalter zu ernähren und welche engen Grenzen natĂĽrÂliche VorausÂsetzunÂgen wie Wetter und BodenÂbeschaffenÂheit den Menschen damals in der LandÂwirtÂschaft setzten. Zugleich aber auch, wie flexibel und innoÂvativ sie damit umzuÂgehen verstanden.

Die RĂĽcksÂtändigÂkeit des europäÂischen MittelÂalters ist zu einem geflĂĽÂgelten Wort geworden. Welche ökoÂnomiÂschen InnoÂvationen sprechen dagegen?

Es gibt viele wirtÂschaftsÂhistoÂrische Mythen, die sich mit der VorÂstellung vom MittelÂalter verbinden. Zum Beispiel, dass die HandÂwerksÂzĂĽnfte besonders innoÂvations- oder technikÂfeindlich gewesen wären. Stattdessen lassen sich zahlÂreiche techniÂsche EntwickÂlungen wie der RäderÂpflug, die WindÂmĂĽhle, die Brille oder der horiÂzontale WebÂstuhl ausÂmachen, die ihren Ursprung im MittelÂalter hatten. Oder nehmen Sie beispielsÂweise das WahrÂzeichen LĂĽneburgs, den „Alten Kran“ im Hafen. Was heute zu besichÂtigen ist, wurde 1797 neu gebaut, der Kran an dieser Stelle geht aber auf das MittelÂalter zurĂĽck. Es handelte sich nur um einen von mehreÂren Kränen und eine VerordÂnung des LĂĽneburger StadtÂrates legte fest, welche Waren von welchem Kran zu welchem Preis zu heben waren. AllerÂdings vollÂzogen sich diese techniÂschen NeueÂrungen häufig ĂĽber GeneÂratioÂnen und nur selten sind wir ĂĽber die eigentÂlichen Erfinder inforÂmiert. So ist das MittelÂalter eben keine Phase des 1000-jährigen StillÂstands, sondern eher eine der einer kontinuÂierliÂchen WeiterÂentwickÂlung.
InwieÂweit haben ökoÂnomiÂsche und techÂnische InnoÂvatioÂnen des MittelÂalters fĂĽr uns heute noch Relevanz?
Die Wirtschaft des MittelÂalters begegnet uns noch heute im SprachÂgebrauch in zahlÂreichen SprichÂwörtern. So geht die Redensart „Ein X fĂĽr ein U vormachen“ auf die mittelÂalterÂliche RechnungsÂlegung mit römischen Zahlen zurĂĽck, bei denen ein X fĂĽr 10 und ein U oder V fĂĽr 5 stand. VerlänÂgerte man das V um zwei Striche, so konnte man mit einem X die Summe also auf einen Schlag verdoppeln. Im BankenÂwesen heute selbstÂverständÂliche Dinge wie der barÂgeldlose ZahlungsÂverkehr oder die VersicheÂrung wertvoller FrachtÂgĂĽter sind im MittelÂalter entstanden. Der „Wechsel“ ermögÂlichte seit dem 13. JahrÂhundert erstmals, eine GeldÂsumme durch die Ăśbergabe eines StĂĽckes Papier ohne den aufÂwendigen und risikoÂreichen Transport von Bargeld zu ĂĽbertragen.

Das MittelÂalter war eine stark christÂliche geprägte Zeit – Ă–konomie und Christentum, wie hat sich das vertragen?
Häufig eher schlecht, denn im Neuen Testament wurden der Erwerb und Besitz von Reichtum in der Regel negativ beurÂteilt. „Leichter geht ein Kamel durch ein NadelÂöhr, als dass ein Reicher in das Reich Gottes gelangt“, hatte Christus gelehrt – und so erforÂderten HandelÂsunternehÂmungen mit dem Ziel des ökonoÂmischen Gewinns eine besonÂdere LegitiÂmation. Dies betraf im BesonÂderen alle reinen GeldÂgeschäfte wie den Kredit mit ZinsÂnahme. Mit der zunehÂmenden BedeuÂtung des städÂtischen PatriÂziats, das sich aus den Reihen der reichen KaufÂleute und HandÂwerker rekruÂtierte, und dessen EinÂfluss auf die KirchenÂbauten und die KirchenÂkunst in Form von StifÂtungen entwickelÂten sich im SpätÂmittelÂalter theoÂlogische BegrĂĽnÂdungen fĂĽr die Toleranz von ReichÂtĂĽmern, weil der KaufÂmann dafĂĽr Risiken auf sich nahm und den Gewinn wieder fĂĽr karitaÂtive Zwecke ausgab. Auch beschäfÂtigte die DisÂkussion um den „gerechten Preis“ immer wieder die GemĂĽter der groĂźen Theologen und PhiloÂsophen des Mittelalters.
Ihr Band eröffnet unsere neue fĂĽnfÂbändige Reihe „EinfĂĽhrung in die WirtschaftsÂgeschichte“, die Sie herausgeben. Was können unserer Leser aus diesen BĂĽchern lernen?

Dass ökonomiÂsches Handeln schon immer eine TriebÂfeder menschÂlichen Daseins gewesen ist und DiskusÂsionen ĂĽber rechtÂmäßig erworÂbenen ReichÂtum und unverÂschulÂdete Armut nicht neu sind. Aber auch, dass KlimaÂveränÂderunÂgen die menschÂliche Existenz entscheiÂdend beeinÂflussen oder gar bedrohen können und dass es sozial und ökonoÂmisch motiÂvierte MobiÂlität und MigraÂtion zu allen Zeiten der MenschÂheitsÂgeschichte gegeben hat – insgeÂsamt also zahlÂreiche Themen, die uns noch heute beÂschäfÂtigen. WirtÂschaftsÂgeschichte ist desÂhalb so aktuell wie nie. Vor allem aber soll die Reihe ein VerständÂnis fĂĽr und Freude an wirtÂschaftsÂhistoÂrischen ThemenÂstellungen wecken. Wenn das gelingt, ist unser Ziel als AutoÂrinnen und Autoren erfĂĽllt.
Das Interview mit dem Autor PD Dr. Sebastian Steinbach fĂĽhrte Dr. Julius Alves aus dem Lektorat des Bereichs Geschichte/ Politik/ Gesellschaft.
Bleiben Sie auf dem Laufenden –
Abonnieren Sie den Kohlhammer Newsletter