Es wird nur wenige Praktikerinnen und Praktiker wundern, dass das Buch ãPflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhausã nun seine zweite Auflage erlebt. Der Gesundheits-und Pflegewissenschaftler Klaus Wingenfeld arbeitet sich nicht ohne Grund an der AlltûÊglichkeit der Entlassungen in den Kliniken ab. Die Gewohnheiten sind fehleranfûÊllig. Doch bietet das Buch MûÑglichkeiten der SchûÊrfung des Entlassungsmanagements an. Christoph Mû¥ller hat Klaus Wingenfeld gesprochen.
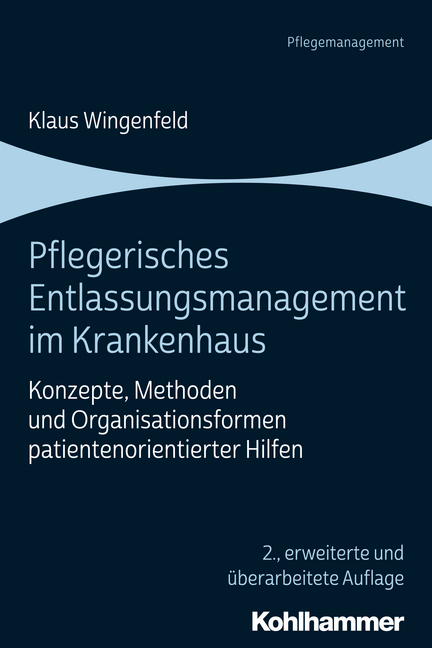 Neu!
Neu!Klaus Wingenfeld
Pflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhaus
Konzepte, Methoden und Organisationsformen patientenorientierter Hilfen
2., erweiterte und û¥berarbeitete Auflage
2020. 133 Seiten, 6 Abb., 1 Tab. Kart. 㘠29,ã
ISBN 978-3-17-036244-4
Die Grundlegungen in Ihrem Buch ãPflegerisches Entlassungsmanagement im Krankenhausã sprechen fû¥r sich. In aller Klarheit legen Sie dar, was getan werden muss, wenn Menschen den ûbergang aus dem Krankenhaus in die eigene HûÊuslichkeit oder in eine Pflegeeinrichtung erleben. Wieso ist der Graben zwischen der Theorie und der oft erlebten schwierigen Praxis gegeben?

Weil das Fehlen von Aufmerksamkeit fû¥r die Zeit nach der Krankenhausentlassung in den Strukturen der Krankenhausversorgung angelegt ist. Eine gute Idee oder ein gutes Konzept zu haben reicht daher nicht aus.
Die Arbeit im Krankenhaus ist sehr stark auf das ãHier und Jetztã ausgerichtet. Je knapper die personellen Ressourcen sind, umso deutlicher macht sich diese Tendenz bemerkbar. Im Krankenhausalltag steht daher der Gedanke, dass ein groûer Teil der KrankheitsbewûÊltigung der Patienten und AngehûÑrigen erst nach dem Krankenhausaufenthalt stattfindet, nicht gerade im Vordergrund. Die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ist auf die aktuelle Gesundheit des Patienten, auf die aktuellen Anforderungen der Pflege und Behandlung im Krankenhaus gerichtet. Hier gibt es zahlreiche Bedû¥rfnisse und Probleme, mit denen sie sich auseinandersetzen mû¥ssen.
Viele Pflegende und ûrzte haben auch nicht sehr viel Erfahrung mit der Versorgung in der HûÊuslichkeit oder in einer Pflegeeinrichtung. Zum Beispiel war die Ausbildung zur Krankenpflege in Deutschland immer schon sehr krankenhauslastig. WûÊhrend der Ausbildung gab es einen mehrwûÑchigen Praxiseinsatz bei einem ambulanten Pflegedienst, aber das fûÊllt meist wenig ins Gewicht. Auûerdem erfahren die Mitarbeiter im Krankenhaus in der Regel nichts oder nur wenig darû¥ber, wie es dem Patienten nach der Entlassung ergangen ist. Wie heiût es so schûÑn? Aus den Augen, aus dem Sinn. Monat fû¥r Monat, Jahr fû¥r Jahr. Natû¥rlich prûÊgt dies das Problembewusstsein. Und nicht zu vergessen: Das Wissen, dass es einen Sozialdienst oder eine andere Stelle gibt, die sich um das Entlassungsmanagement kû¥mmern, verstûÊrkt ebenfalls die Tendenz, sich mit Fragen der poststationûÊren Situation wenig auseinanderzusetzen.
Schon allein deshalb kann nicht erwartet werden, dass ein Interesse an der Zeit nach der Krankenhausentlassung von selbst entsteht. In der ûÑffentlichen Diskussion und auch in der politischen Diskussion ist es û¥brigens ganz ûÊhnlich. Wenn wir beispielsweise û¥ber die Wirksamkeit der Krankenhausbehandlung sprechen, so wird meist nicht thematisiert, dass ihre langfristigen Erfolge vielfach davon abhûÊngen, wie es in den ersten Wochen nach der Krankenhausentlassung weitergeht. Eine Ausnahme bildet dabei lediglich das Thema Rehabilitation. Der Erfolg eines Krankenhauses wird an anderen Aspekten festgemacht: an der wirtschaftlichen Situation und damit einer geringen Krankenhausverweildauer, an hohen Behandlungszahlen, an einer geringen Sterblichkeit der Patienten wûÊhrend des stationûÊren Aufenthalts , an der ausreichenden Verfû¥gbarkeit von ûrzten und Pflegenden, vielleicht auch am freundlichen Auftreten der ûrzte. Aber ungeplante Wiederaufnahmen der Patienten? Sterblichkeit oder gesundheitliche Komplikationen nach der Krankenhausentlassung? Das Belastungserleben der Patienten und AngehûÑrigen in der poststationûÊren Phase? Fehlanzeige.
Also: Die Aufmerksamkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter richtet sich naturgemûÊû auf das, was im Krankenhaus passiert, weniger darauf, was spûÊter kommt. Ebenso das Interesse der Institution Krankenhaus. Ein professionelles Entlassungsmanagement entsteht daher nicht von selbst oder nur deshalb, weil es fachlich angezeigt ist. Es muss gewissermaûen gegen die Gewohnheiten und Alltagsroutinen, gegen die bestehenden Anreizsysteme im Krankenhaus durchgesetzt werden. Das macht es schwer und die Implementierung hûÊufig zu einem Kraftakt.
Das Deutsche Netzwerk fû¥r QualitûÊtsfûÑrderung in der Pflege (DNQP) hat das Entlassungsmanagement schon frû¥h mit einem Expertenstandard in den Blick genommen. Gleichzeitig vermitteln pflegerische Praktikerinnen und Praktiker einen Expertenstandard fû¥r die Aufnahme in ein Krankenhaus oder in eine Pflegeeinrichtung. Die Aufnahmesituation wird bekanntlich als Weichenstellung fû¥r die Behandlung erlebt und beschrieben. Wie kommt es zu diesem ãDefizitã?
Es gab sogar Diskussionen darû¥ber, ob es nicht sinnvoll wûÊre, einen allgemeinen Standard fû¥r den ûbergang zwischen den verschiedenen Versorgungsumgebungen zu definieren. Ich bin kein Freund solcher breit angelegten Konzepte, denn sie mû¥ssen, um fû¥r alle Situationen anwendbar zu sein, recht allgemein formuliert werden, und das geht zu Lasten des Nutzens fû¥r die Praxis. Bei nûÊherem Hinsehen zeigt sich manchmal sogar, dass es lediglich um die Standardisierung der Informationsû¥bermittlung geht (z.B. in Form der schon seit vielen Jahren bekannten einheitlichen ûberleitungsbûÑgen oder Pflegebriefe). Das wûÊre ein ziemlich verkû¥rzter Ansatz. Aus der Patientenperspektive ergeben sich bei Aufnahme und Entlassung auûerdem ganz unterschiedliche Anforderungen. Aufnahme und Entlassung im Krankenhaus sind wiederum ganz anders zu diskutieren als Aufnahme und Entlassung im Bereich der stationûÊren Langzeitpflege oder der ambulanten Pflege.
Aus dem Blickwinkel des einzelnen Krankenhauses ist es sehr angebracht, den Aufnahme- und Entlassungsprozess im Zusammenhang zu betrachten, da ja die Entlassungsvorbereitung mûÑglichst rasch beginnen sollte. Die Regelung in einem fachlichen Standard ist aber eine andere Frage.
Sie betonen in dem Buch die Rolle der AngehûÑrigen von Betroffenen. Wie kommt es dazu, dass die AngehûÑrigen von den professionell Pflegenden eher als StûÑrfaktoren denn als Kooperationspartner wahrgenommen werden?
Das kommt vor. Wie hûÊufig bzw. bei wie vielen und welchen Mitarbeitern, wissen wir allerdings nicht. Also Vorsicht mit Pauschalisierungen.
Wenn AngehûÑrige als StûÑrfaktor wahrgenommen werden, hûÊngt das zum Teil mit einer û¥bermûÊûigen Fixierung der Pflegenden auf die krankenhausinternen Prozesse zusammen, in denen die AngehûÑrigen streng genommen keine wirkliche Funktion haben. Die Anwesenheitszeiten der AngehûÑrigen passen auûerdem oft nicht zum zeitlichen Rhythmus der Pflege. Teilweise sind Pflegende aber auch genervt, weil sie anstelle eines gerade nicht greifbaren Arztes Auskunft geben mû¥ssen, obwohl sie bei bestimmten Themen nicht dazu autorisiert sind.
Die Zusammenarbeit mit AngehûÑrigen ist mit besonderen, zusûÊtzlichen Anforderungen verbunden. Sie stellen andere Fragen als der Patient selbst und bringen eigene Unsicherheiten, Sorgen und ûngste mit. Sie treten eventuell auch offensiver auf. Eine besondere Herausforderung im Entlassungsmanagement entsteht durch unterschiedliche Sichtweisen der Patienten und AngehûÑrigen, etwa im Hinblick auf die Bereitschaft und FûÊhigkeit, eine Pflege zu Hause zu û¥bernehmen. Forschungsergebnisse zeigen, dass Patienten in dieser Hinsicht oft deutlich optimistischer sind als die AngehûÑrigen selbst. Die Chancen, ein realistisches Bild von der erwartbaren Situation im hûÊuslichen Umfeld der Patienten zu erhalten, wachsen durch die Kooperation mit ihnen enorm. Bei pflegebedû¥rftigen Patienten ist oft entscheidend, welche Rolle die AngehûÑrigen spûÊter û¥bernehmen wollen und kûÑnnen.
Von daher: Es ist fû¥r mich nachvollziehbar, wenn Pflegende auf der Station AngehûÑrige manchmal als zusûÊtzlichen Stressfaktor erleben. Im Rahmen des professionellen Entlassungsmanagements sollte das allerdings nicht passieren.
Die Zusammenarbeit mit den Betroffenen kommt in Ihrem Buch sicherlich zu kurz. Hilfen kûÑnnen nur organisiert werden, wenn die Betroffenen von der eigenen Bedû¥rftigkeit û¥berzeugt sind. So habe ich Ausfû¥hrungen vermisst, die den Eigensinn der Betroffenen im Blick haben. Das Entlassungsmanagement kann noch so gut (gewesen) sein, es scheitert, wenn beispielsweise der ambulante Pflegedienst in den eigenen vier WûÊnden sabotiert wird. Was sagen Sie dazu?
Ja, das ist ein wichtiger Punkt. Und es stimmt auch, dass dies in meinem Buch wenig thematisiert wird.
Wir hatten in unseren Projekten einmal einen Patienten, der sagte, er wolle keinen Antrag bei der Pflegeversicherung stellen, weil er ja gar nicht pflegebedû¥rftig sei ã was den ûrzten denn einfiele, so etwas zu behaupten. Ein anderer Patient wollte keinen Pflegedienst in Anspruch nehmen, sondern lieber Pflegegeld, weil er meinte, seine studierende Enkeltochter kûÑnne das Geld besser gebrauchen als er selbst. Manche Patienten und AngehûÑrige mûÑchten so rasch wie mûÑglich wieder in die gewohnten Alltagsroutinen zurû¥ckkehren und verschlieûen sich gegenû¥ber einer Beratung zur Anpassung ihres Lebens an eine dauerhaft verûÊnderte gesundheitliche Situation. Auch die Inanspruchnahme eines ambulanten Pflegedienstes kann, wie Sie andeuten, Widerstand hervorrufen. Wie hilfreich auch immer ambulante Pflege sein mag: Sie fû¥hrt zu einer Verletzung der IntimsphûÊre, mit der sich Patienten und AngehûÑrige erst einmal anfreunden mû¥ssen.
Dies zu wissen und die eigene Beratung darauf auszurichten, macht aber die ProfessionalitûÊt des Entlassungsmanagements aus. Es geht eben um weit mehr als Informationen û¥ber Leistungsansprû¥che, die Beantragung von Pflegegeld oder die Hilfe bei der Suche nach einem Dienst. Klar ã Patienten haben ûngste, eigene und manchmal schwer nachvollziehbare PrûÊferenzen, gelegentlich vielleicht auch wirklichkeitsfremde Erwartungen. Im Entlassungsmanagement muss man damit umgehen. Voraussetzung dazu sind BeurteilungsvermûÑgen und eine gut entwickelte kommunikative Kompetenz.
Von daher sehe ich in ihrer Anmerkung einen Widerspruch: Ein Entlassungsmanagement, in dem die ablehnende Haltung des Patienten gegenû¥ber ambulanter Pflege nicht aufgefallen ist, kann eigentlich nicht ãgut (gewesen) seinã.
Trotz aller Mû¥he wird es am Ende natû¥rlich immer wieder Patienten geben, die erforderliche Hilfen ablehnen oder ein Verhalten zeigen, was ihnen noch mehr gesundheitliche Probleme beschert als sie ohnehin schon haben. Aber das sind nach meinen (Projekt-)Erfahrungen Ausnahmesituationen.
Sie deuten viele Schwierigkeiten in der Versorgung mit Pflegehilfsmitteln an. Pflegende in den KrankenhûÊusern haben dies oft nicht im Blick. Inwiefern sollten Pflegehilfsmittel, aber auch Hintergrundwissen zu sozialrechtlichen Fragen Inhalte von Fortbildungen sein. Oder ist dies illusionûÊr?
Pflegehilfsmittel sind tatsûÊchlich ein groûes Problem. Wir haben gerade hier in Deutschland eine Unmenge an unterschiedlichen Varianten von Hilfsmitteln und FinanzierungszustûÊndigkeiten, bei denen selbst Spezialisten sagen, dass sie sich etwas û¥berfordert fû¥hlen. Insofern bin ich skeptisch gegenû¥ber der Annahme, das Problem lieûe sich durch Fortbildung der Pflegenden lûÑsen. Sicherlich nur zum Teil. Grundlagenwissen zum Thema Hilfsmittelversorgung sollte bei FachkrûÊften in der Pflege immer vorhanden sein, ebenso wie Grundlagenwissen û¥ber sozialrechtliche Strukturen. Aber eben Grundlagenwissen.
Fû¥r diejenigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeit, die fû¥r die Entlassungsvorbereitung zustûÊndig sind, gelten aber hûÑhere Anforderungen. Sie mû¥ssen die Hilfsmittelproblematik kennen und sich auch mit den wichtigsten sozialrechtlichen Anforderungen auskennen. Wenn Sie also Fortbildung der Mitarbeiter meinen, die fû¥r das Entlassungsmanagement zustûÊndig sind, dann haben sie vûÑllig Recht. Hier sind spezifische Kenntnisse bzw. Fortbildungen gefragt. Ausbildungswissen genû¥gt nicht.
Aber wir dû¥rfen wiederum auch nicht vergessen: In vielleicht 90 % der FûÊlle geht um sehr ûÊhnliche Fragen: Gehhilfen, Pflegebett, erhûÑhter Toilettensitz, Beantragung einer Begutachtung, Wohnraumanpassung, Schwerbehindertenausweis usw. Sich das erforderliche Wissen anzueignen ist durchaus machbar.
Sie unterstreichen fû¥r die tûÊgliche Arbeit die Wichtigkeit der organisierten Entlassungsplanung, machen auch VorschlûÊge fû¥r spezifische Verantwortlichkeiten. Denkt man Ihre Ideen weiter, so mû¥ssten sich Kliniken anders organisieren. Im Alltag dominiert jedoch eine Haltung, dass Aufgaben erledigt sein mû¥ssen. Es geht weniger um die Konturierung der eigenen Arbeit.
Ganz genau: Ein professionelles Entlassungsmanagement setzt die Anpassung von AblûÊufen und eine klare Zuordnung von ZustûÊndigkeiten voraus. Aber das heiût nicht, das Krankenhaus vûÑllig neu zu organisieren.
Nehmen wir das Beispiel initiales Assessment, also die EinschûÊtzung der Frage, ob bei einem Patienten ein erhûÑhtes Risiko besteht, nach der Krankenhausentlassung gesundheitliche Komplikationen oder Versorgungsprobleme zu erleben. Ein solches Assessment umfasst vielleicht 6 bis 10 Kriterien und lieûe sich ohne Probleme in die Aufnahmeprozedur im Krankenhaus integrieren. Doch obwohl wir schon beinahe zwei Jahrzehnte darû¥ber diskutieren, dass der Bedarf des Patienten hûÊufig zu spûÊt erkannt wird die Entlassungsvorbereitung dann viel zu spûÊt einsetzt, ist das lûÊngst noch nicht der Regelfall. Dabei wûÊren die ûnderungen sehr û¥berschaubar. Eigentlich geht es nur um zwei Dinge: A) Jemand muss das entsprechende Assessment durchfû¥hren, entweder der fû¥r das AufnahmegesprûÊch zustûÊndige Arzt oder eine Pflegende beim AufnahmegesprûÊch auf der Station. B) Das Ergebnis muss an die zustûÊndige Stelle (z.B. Pflegeû¥berleitung, Sozialberatung, Sozialdienst) weitergeleitet werden.
Das wûÊre schon alles. Weitere Prozesse wûÊren nicht erforderlich, um das initiale Assessment in die AblûÊufe zu integrieren. Und was das û¥brige Entlassungsmanagement angeht, sind die Anpassungen ebenfalls û¥berschaubar. Die grûÑûte Herausforderung bringt vielleicht die Aufwertung der sog. edukativen Aufgaben mit sich (Information, Anleitung und Beratung zu Fragen der hûÊuslichen Versorgung), aber das ist zum Teil ja bereits Bestandteil des Versorgungsalltags (z.B. in der Urologie: Anleitung zum Umgang mit einem Blasenkatheter).
Insofern ist tatsûÊchlich schwer nachvollziehbar, weshalb die Entwicklung in der Krankenhauslandschaft nicht schon lûÊngst weiter ist. Hierzu noch ein weiteres Beispiel: In Deutschland, genauer gesagt im Bundesland Nordrhein-Westfalen, wurde vor einiger Zeit ein Screening fû¥r ûÊltere Patienten bei der Krankenhausaufnahme gesetzlich vorgeschrieben. Vorrangiges Ziel war die Identifizierung von besonderen Risiken, die im Zusammenhang mit der Behandlung ûÊlterer Patienten im Krankenhaus auftreten kûÑnnen. Die Kriterien, die dabei zur Anwendung kommen, eignen sich aber auch zur KlûÊrung der Frage, ob bei den Patienten eine besondere Problematik nach der Krankenhausentlassung zu erwarten ist. Es wûÊre daher ein Leichtes gewesen, dieses Screening auch im Rahmen der Entlassungsplanung zu verwenden. Einige KrankenhûÊuser haben das auch getan, aber nicht die Mehrheit. Mit anderen Worten: Ein Teil der relevanten Prozesse war ohnehin angepasst, und trotzdem gelang es in vielen HûÊusern nicht, eine vorhandene Information krankenhausintern weiterzuleiten. Schwer nachvollziehbar.
Was kann, was sollte passieren, um beispielsweise den Anforderungen entsprechen zu kûÑnnen? Welche Vision haben Sie zu einem Entlassungsprozess im Krankenhaus?
Die aktuellen Erfahrungen zeigen, dass der Bewusstseinswandel in den meisten KrankenhûÊusern noch aussteht. Es wûÊre wû¥nschenswert, dass alle Krankenhausmitarbeiter den Patienten und die ihn betreffenden Versorgungsfragen immer auch aus der Perspektive seiner poststationûÊren Lebenssituation heraus beurteilen. Das kann man nicht durch formale Regeln erzwingen, es erfordert vielmehr eine Reflexion von Grundhaltungen und der Kommunikationskultur im Krankenhaus. Das Wort ãPatientenorientierungã, das in der heutigen Krankenhausversorgung im Unterschied zu ãKundenorientierungã nur noch wenig benutzt wird, spielt dabei eine wichtige Rolle. Patientenorientierung bedeutet unter anderem, den Krankenhausaufenthalt aus der Perspektive des Patienten zu sehen, nûÊmlich als wichtige, aber kurze Episode in einer lûÊngeren, manchmal sehr langen Krankheitsphase ã eine Episode, in der Patienten und AngehûÑrige auf die zum Teil schwierigen Probleme und Anforderungen der KrankheitsbewûÊltigung gut vorbereitet werden mû¥ssen.
Ein zweiter Punkt: Es muss geeignete Strukturen geben, das heiût zustûÊndige Stellen, die das Entlassungsmanagement durchfû¥hren und darauf spezialisiert sind. Und hier mû¥ssen wir eben feststellen, dass die alten Strukturen, in denen allein Sozialarbeit und SozialpûÊdagogik das Entlassungsmanagement verantwortet haben, nicht ausreichen. Es geht zunehmend um Menschen, die û¥ber eine lûÊngere Zeit oder sogar auf Dauer pflegebedû¥rftig sind, und deshalb muss insbesondere die Pflege eine starke Rolle im Entlassungsmanagement erhalten.
Darû¥ber hinaus wûÊre es unbedingt wichtig, dass sich die KrankenhûÊuser stûÊrker als bisher mit den unterschiedlichen Konzeptionen des Entlassungsmanagements auseinandersetzen. Konzepte der ûbergangsversorgung, bei denen besonders qualifizierte Pflegende bestimmte Patienten (Risikogruppen) in den ersten Wochen nach der Krankenhausentlassung begleiten, zu Hause aufsuchen, dort anleiten und beraten und, wenn nûÑtig, andere Hilfen koordinieren, sind noch weitgehend unbekannt und werden in Deutschland lediglich in Modellprojekten erprobt. In den USA gibt es sie seit den 1980er Jahren. Dort gelten sie als Meilenstein in der Pflege und als einfache und wirksame MûÑglichkeit, QualitûÊt und Wirtschaftlichkeit miteinander zu verknû¥pfen.
Ansonsten sollten die Krankenhausleitungen den Nationalen Expertenstandard zum Entlassungsmanagement in der Pflege stûÊrker wie eine Checkliste nutzen: Haben wir ein initiales Assessment? Mû¥ssen hier ZustûÊndigkeiten neu definiert werden? Wie (gut) funktioniert das interne Meldewesen? Wie gut funktioniert die Beratung und Anleitung zur Vorbereitung von Patienten und AngehûÑrigen auf die Zeit nach der Entlassung? Ist die interne Abstimmung im Vorfeld der Entlassung sichergestellt?
Die Implementierung eines professionellen Entlassungsmanagements ist wirklich kein Hexenwerk. Aber es muss gewollt sein und auch finanziert werden.
Das Interview fû¥hrte Christoph Mû¥ller, der uns dieses freundlicherweise zur Verfû¥gung stellte. Das Interview wurde zuerst auf der Website www.pflege-professionell.at verûÑffentlicht.
Bleiben Sie auf dem Laufenden ã
Abonnieren Sie den Kohlhammer Newsletter