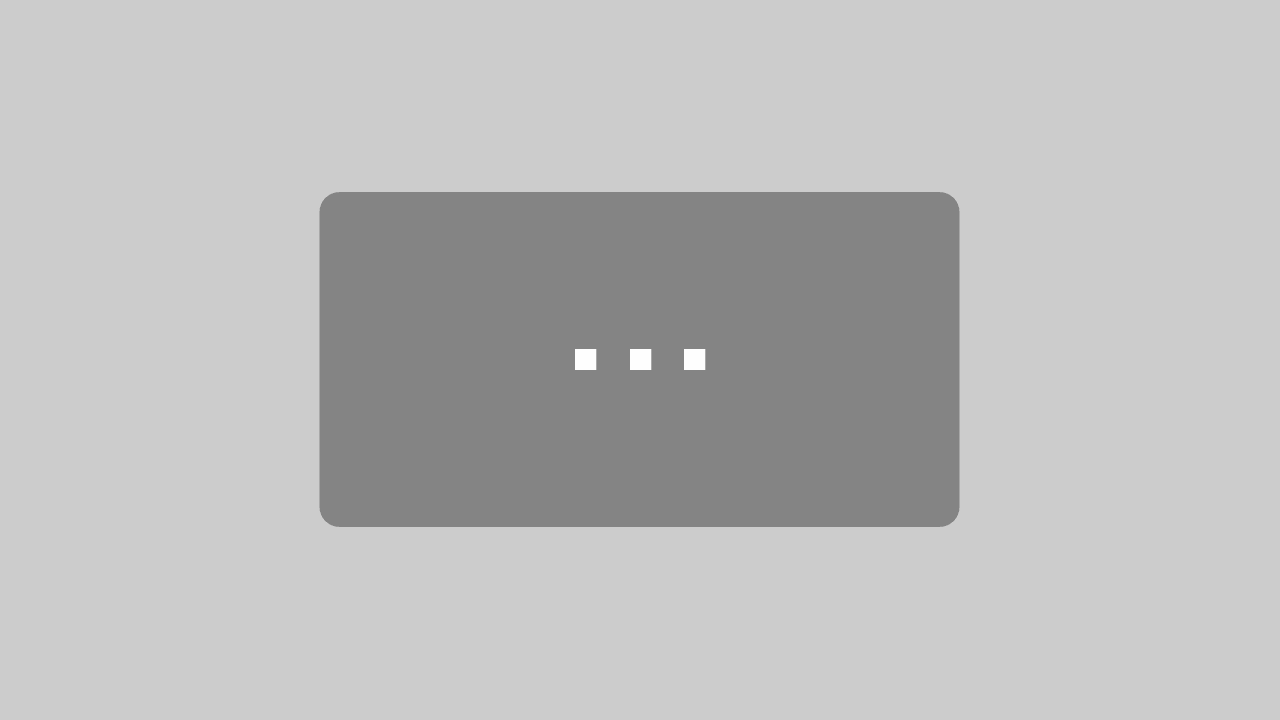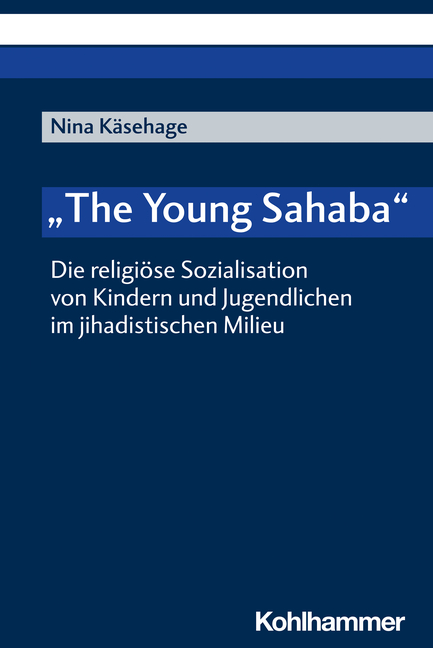Zwischen den Welten – Jihadistische Mütter mit ihren Kindern in Deutschland und in Syrien
Anlässlich der Veröffentlichung ihrer Habilitationsschrift „The Young Sahaba“ über die Sozialisation von Kindern und Jugendlichen im jihadistischen Milieu führten wir ein Interview mit der Autorin, der Religionswissenschaftlerin PD Dr. Nina Käsehage. Darin beleuchten wir einerseits die Inhalte wie Umstände ihrer Forschung, und andererseits erkunden wir darüber hinausgehende aktuelle wie gesellschaftsrelevante Themen.

(Foto: picturepeople)
Wie sind Sie auf das Themenfeld Islamismus/Jihadismus aufmerksam geworden und wann haben Sie begonnen, in diesem Feld wissenschaftlich zu forschen?
Durch meine Interviews mit namhaften deutschen Salafisten wie Sven Lau und Pierre Vogel, die ich im Rahmen meiner Studie zu deutschen KonvertitInnen zum Islam im Jahr 2011 zu ihren Motivlagen zur religiösen Konversion befragte, kam ich erstmals persönlich in Kontakt mit Salafisten. Hieraus ergaben sich Kontakte in die deutsche salafistische und weiterführend in die europäische radikal-islamische Szene, so dass ich in Deutschland und acht europäischen Ländern Interviews mit SalafistInnen und JihadistInnen führen konnte. Die Ergebnisse dieser qualitativen Religionforschung sind u.a. meiner Dissertation ‚Die gegenwärtige salafistische Szene in Deutschland – Prediger und Anhänger‘ (2018) zu entnehmen.
Wie sind Sie auf das Thema Ihrer Habilitation gekommen und was ist für Sie das Interessante daran?
Der physische Anschluss einiger meiner früheren Interview-Partnerinnen aus dem deutschen jihadistischen Milieu mit ihren Kindern an den Islamischen Staat (IS) und deren dortige religiöse Sozialisation stellt für mich eine weitere Entwicklung in der Radikalisierung vulnerabler Gruppen dar, die bislang empirisch noch unterforscht ist. Wichtig ist dabei stets das Verständnis dafür, dass diese Kinder nicht selbst die Entscheidung getroffen haben, sich einer jihadistischen Ideologie oder Gruppe anzuschließen, sondern durch ihre Erziehungsberechtigten fremdbestimmt in dieses extremistische Milieu gelangten. Als Religionswissenschaftlerin mit einer religionspsychologischen Ausrichtung stellten sich für mich infolgedessen sowohl Fragen hinsichtlich der gender-bezogenen Selbstverortung der Mütter als Teil des ‚Kalifats‘ als auch – mit Blick auf die Adaption der IS-Werte und -Normen und der religiösen Entwicklung der Kinder im ‚Kalifat‘ – nach ihrer Rückkehr. Religionspädagogisch interessant sind darüber hinaus für mich auch Fragen des Umgangs der zurückgekehrten Kinder und Jugendlichen und ihrer Mütter mit ihren nicht-jihadistischen Peer Groups.
Wie haben Sie mit Ihren Interview-PartnerInnen Kontakt geknüpft und über diese lange Zeitspanne gehalten?
Der Kontakt kam durch meine Interviews mit deutschen Jihadistinnen zustande, die ich im Rahmen meiner Studie ‚Frauen im Dschihad – Salafismus als transnationale Bewegung‘ (2023) mit deutschen und europäischen Jihadistinnen befragen konnte. Über einen Zeitraum von drei Jahren habe ich die Kinder/Jugendlichen und ihre Mütter befragt. Dies passierte aus Sicherheitserwägungen während ihrer Zeit beim IS per E-Mail, infolge ihrer Rückkehr nach Deutschland und nach einem Jahr ihres hiesigen Ankommens persönlich. Ihre Entwicklungen konnte ich am besten über eine Längsschnittstudie nachzeichnen, da die jungen Befragten, aber auch ihre Mütter als Erwachsene, natürlich verschiedene Entwicklungsstadien im Zusammenhang mit ihren (Gewalt-)Erfahrungen beim IS gemacht haben. So etwas zu verarbeiten braucht ein sicheres Umfeld, Zeit, aber vor allem familiäre, religionspädagogische und psychologische Betreuung. Erst dann ist eine Re-Integration dieser Gruppen in die deutsche Gesellschaft meiner Erfahrung nach realistisch.
In Ihrem Buch beschreiben Sie unter anderem die vielfältigen und teils nicht-religiösen Beweggründe, welche die zum Islam konvertierten Mütter hatten, um in den IS auszureisen und „ihre Kinder mit auf eine Reise ins Ungewisse“ zu nehmen. Im Zentrum Ihrer Studie stehen jedoch die gender-sensiblen Themen wie etwa die geschlechtsspezifische Erziehung und Indoktrinierung der „Young Sahaba“ – wie die Kinder der jihadistischen Mütter genannt werden – durch den IS in Syrien sowie das dort zu erfüllende Mutterbild. Darüber hinaus wird in Ihrer Studie durch die Nähe der Interviews auf dramatische Weise deutlich, aus welchen Gründen die Mütter wieder nach Deutschland zurückgekommen sind und wie die „Wiedereingliederung“ aller RückkehrerInnen verlief. Gab es hierzu staatlicherseits Unterstützungsprogramme und Hilfsangebote zur „Resozialisierung“?
Ich denke, dass dahingehend viele Länder noch in den Kinderschuhen stecken. In Frankreich und auf dem Balkan gibt es aufgrund der großen Anzahl von ausgereisten bzw. zurückgekehrten Müttern und ihrer Kinder bereits einige gute Initiativen. In Deutschland beschäftigen sich meines Wissens nach einige wenige PsychologInnen, TherapeutInnen und De-Radikalisierungs-/Präventions-Stellen damit. Hier wäre bspw. der Verein IFAK e.V. mit seiner aktuellen Initiative ‚Pro Kids‘ zu benennen.
Wie sollte die deutsche Gesellschaft Ihrer Meinung mit den RückkehrerInnen umgehen?
Zunächst ist darauf hinzuweisen, dass jeder Fall individuell ist. Das Wissen darum ist insofern wichtig, um zu verhindern, dass voreilige Schlüsse oder populistische Forderungen seitens spezifischer Interessengruppen in Bezug auf diese Gruppe gezogen bzw. gestellt werden. Dann ist es notwendig, verstärkt in die psychologische Betreuung der Zurückgekehrten und ihrer Kinder zu investieren, am besten begleitet von religionsaffiner Expertise, damit in den konkreten Fällen bestimmte religiöse Einstellungen und Werturteile besser nachvollzogen werden können. Nur dann können die Betroffenen angemessen betreut werden, so dass ihre psychische Abnabelung vom IS erfolgen kann. Diese ist eine essentielle Voraussetzung für ihre Re-Integration. Nur wer mit dem Kopf und dem Herzen in der deutschen Gesellschaft angekommen ist, wird diese als einen Ort betrachten, mit dem er/sie sich identifiziert. Dadurch kann eine bestehende Ideologisierung oder eine Folge-Radikalisierung vor Ort, die mitunter aufgrund der Entwurzelung der Betroffenen stattfinden kann, durchbrochen werden.
Welche Empfehlungen würden Sie aufgrund Ihrer Pionierforschung in diesem Themenbereich aussprechen?
Zu empfehlen wäre meiner Ansicht nach eine Investition in einen religionswissenschaftlichen Sachverstand für Arbeitsbereiche, die mit diesen RückkehrerInnen beruflich befasst sind. Hierdurch könnten die zahlreichen Facetten von religiös motiviertem Extremismus zum einen in Gänze erfasst und entsprechende Gutachten und Präventionsmaßnahmen erstellt werden. Für Arbeitsbereiche, die vielmehr mit der De-Radikalisierung oder der Strafverfolgung dieser Gruppe beschäftigt sind, könnte die Breite religionswissenschaftliche Expertise zum anderen dazu genutzt werden, um adäquate De-Radikalisierungs- und Wiedereingliederungsmaßnahmen für die Betroffenen, ihre Familien und deren Opfer einzurichten und anzubieten.
Vielen Dank für das aufschlussreiche Gespräch zu Ihrer wichtigen Forschung.
PD Dr. Nina Käsehage im Interview mit DW Deutsch auf Youtube zum Thema „Lassen sich ehemalige IS-Anhänger wieder integrieren?“ (21. November 2023)
Nina Käsehage
„The Young Sahaba“
Die religiöse Sozialisation von Kindern und Jugendlichen im jihadistischen Milieu
2024. 514 Seiten mit 25 Abb. Kart.
€ 69,–
ISBN 978-3-17-044512-3