


Die Grundlagen bzw. die Funktions¬≠weisen der Ο•konomie sind nicht voraus¬≠set¬≠zungs¬≠los, sondern vielmehr sozialer Natur: Der Wirt¬≠schafts¬≠kreis¬≠lauf, die durch ihn kon¬≠stitu¬≠ierten Geld- und GΟΦter¬≠flΟΦsse sowie die ΟΕkono¬≠mi¬≠schen Insti¬≠tutio¬≠nen ins¬≠gesamt basie¬≠ren auf Bezieh¬≠ungen, ΟΦber die sich auch Erwar¬≠tungs-, Regel- und Ver¬≠trauens¬≠bildung sowie andere ΟΕko¬≠nomi¬≠sche Zusam¬≠men¬≠hΟΛnge erklΟΛ¬≠ren lassen. Die Kenntnis der Wirkungs¬≠weisen sowie der sozio¬≠logi¬≠schen, psycho¬≠logi¬≠schen und ΟΕko¬≠nomi¬≠schen Impli¬≠katio¬≠nen von Bezie¬≠hun¬≠gen ist damit zen¬≠tral fΟΦr das Ver¬≠stΟΛnd¬≠nis einer Ο•ko¬≠nomie; darum dreht sich dieses inter¬≠dis¬≠zipli¬≠nΟΛre Ein¬≠fΟΦh¬≠rungs¬≠werk und thema¬≠ti¬≠siert dabei, wie Digi¬≠tali¬≠sie¬≠rung, Pandemie und sons¬≠tige gesell¬≠schaft¬≠liche Krisen auf das Ein¬≠gehen und Auf¬≠recht¬≠erhal¬≠ten von Bezieh¬≠ungen zurΟΦckwirken.
Mit seiner neuen Buch¬≠publi¬≠kation βÄûBezie¬≠hungs¬≠kompe¬≠tenz. Soziale Bindung in Zeiten von Digi¬≠tali¬≠sie¬≠rung und gesell¬≠schaft¬≠lichen KrisenβÄ€ stellt Professor Dr. Peter Witt, Inhaber des Lehr¬≠stuhls fΟΦr Techno¬≠logie- und Inno¬≠vations¬≠management an der Bergi¬≠schen Univer¬≠sitΟΛt Wupper¬≠tal, die neues¬≠ten Er¬≠kennt¬≠nisse aus Sozio¬≠logie, Psycho¬≠logie und Wirt¬≠schafts¬≠wissen¬≠schaften praxis¬≠nah und ver¬≠stΟΛnd¬≠lich zusammen βÄ™ wir hatten die Gelegenheit, mit den Autor ein kurzes GesprΟΛch zu fΟΦhren.
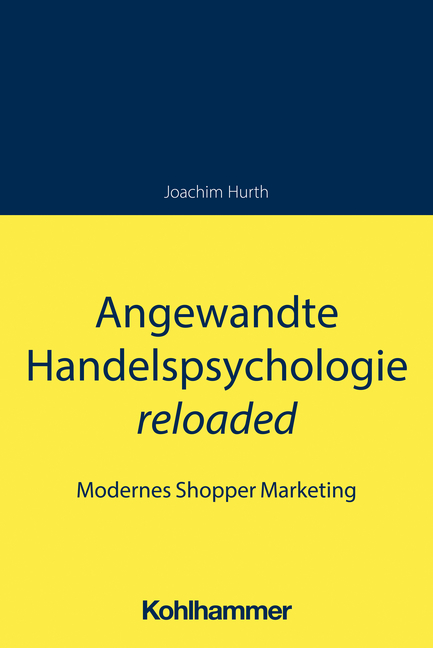
Peter Witt
Beziehungskompetenz
Soziale Bindung in Zeiten von Digitalisierung und gesellschaftlichen Krisen
2023. 220 Seiten. Kartoniert. ⲧ 32,βÄ™
ISBN 978-3-17-043368-7
Inwiefern spielen Beziehungen eine Rolle fΟΦr die Ο•konomie?
Beziehungen spielen in der Ο•kono¬≠mie immer dann eine Rolle, wenn Men¬≠schen mit¬≠ein¬≠ander inter¬≠agie¬≠ren. Das geschieht nicht nur im per¬≠sΟΕn¬≠li¬≠chen Verkauf oder in der Mit¬≠arbei¬≠ter¬≠fΟΦh¬≠rung, sondern auch bei Ko¬≠ope¬≠ratio¬≠nen zwischen Unter¬≠nehmen oder in Lei¬≠tungs¬≠gremien von Unternehmen. Fast alle ΟΕko¬≠nomi¬≠schen Trans¬≠aktio¬≠nen sind sozial ein¬≠gebet¬≠tet, finden also zwischen Menschen statt. Eine Aus¬≠nahme sind elek¬≠troni¬≠sche Trans¬≠aktio¬≠nen, die wir mit Maschi¬≠nen oder auf ano¬≠ny¬≠men Markt¬≠plΟΛtzen durch¬≠fΟΦhren, zum Bei¬≠spiel beim Auto¬≠maten¬≠verkauf, beim Online Brokerage oder beim E-Commerce. Aber selbst da kommt es immer wieder vor, dass wir menschliche Ansprechpartner brauchen, um RΟΦckfragen zu klΟΛren oder Probleme zu beheben. Soziale Bezieh¬≠ungen sind im Ο€bri¬≠gen auch dann von Be¬≠deu¬≠tung, wenn es um Trans¬≠aktio¬≠nen zwi¬≠schen Organi¬≠satio¬≠nen geht, also bei¬≠spiels¬≠weise bei Liefer¬≠anten¬≠bezieh¬≠ungen, bei Ko¬≠opera¬≠tio¬≠nen oder beim Umgang mit BehΟΕrden. Denn Orga¬≠nisa¬≠tionen werden immer ver¬≠tre¬≠ten durch Menschen. Die Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz der betei¬≠lig¬≠ten Per¬≠so¬≠nen ent¬≠schei¬≠det darΟΦber, wie gut oder wie schlecht Orga¬≠nisa¬≠tionen zusammenarbeiten.
In der klassischen BWL fin¬≠det man noch wenig ΟΦber Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz βÄ™ ist das ΟΦber¬≠haupt lehr- und lernbar?
Beziehungskompetenz wird durch¬≠aus in Teil¬≠berei¬≠chen der BWL erforscht und in der ent¬≠spre¬≠chen¬≠den Lehre behandelt. Ein Beispiel ist das Marketing. Es gibt viele wissen¬≠schaft¬≠liche Studien und gute Lehr¬≠bΟΦcher zum Thema per¬≠sΟΕnli¬≠cher Verkauf. In diesem Bereich der BWL war immer klar, dass der Ver¬≠triebs¬≠er¬≠folg eines Unter¬≠nehmens von der Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz seiner Ver¬≠kΟΛufer¬≠innen und VerkΟΛu¬≠fer abhΟΛngt. Ein anderes Bei¬≠spiel ist die Per¬≠sonal¬≠wirt¬≠schaft. Auch dort ist schon seit langer Zeit bekannt, dass die Mit¬≠arbei¬≠ter¬≠moti¬≠vation von der Be¬≠zieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz und der FΟΦh¬≠rungs¬≠kompe¬≠tenz der Vorge¬≠setzten abhΟΛngt.
Ansonsten haben Sie aber sicher Recht. In der klas¬≠sischen BWL wird insge¬≠samt gese¬≠hen noch wenig zu Fragen der Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz ge¬≠forscht und gelehrt. Da findet sich hΟΛufig noch die Vor¬≠stel¬≠lung vom Homo Oeconomicus, dem stets ratio¬≠nal handeln¬≠den wirt¬≠schaft¬≠lichen Akteur, fΟΦr dessen Ver¬≠hal¬≠ten soziale Bezieh¬≠ungen oder psycho¬≠logi¬≠sche Ein¬≠fluss¬≠fakto¬≠ren irre¬≠levant sind. Aber das hat sich auch schon stark geΟΛn¬≠dert. Mit dem Sieges¬≠zug der Behavioral Economics haben Er¬≠kennt¬≠nisse aus der Psycho¬≠logie deut¬≠lich mehr Be¬≠rΟΦck¬≠sich¬≠ti¬≠gung in der klas¬≠sischen BWL erfahren. Ich wΟΦrde auch sagen, dass es mitt¬≠ler¬≠weile mehr Teil¬≠be¬≠reiche der BWL gibt, in denen psycho¬≠logi¬≠sche und sozio¬≠logi¬≠sche Er¬≠kennt¬≠nisse verar¬≠bei¬≠tet werden. Ein Beispiel ist die For¬≠schung zu Fami¬≠lien¬≠unter¬≠nehmen, die ganz klar gezeigt hat, welche groΟüe Rolle fami¬≠liΟΛ¬≠re Bezieh¬≠ungen fΟΦr die unter¬≠nehme¬≠ri¬≠schen Ent¬≠schei¬≠dun¬≠gen haben. Ein anderes Bei¬≠spiel ist die Er¬≠for¬≠schung von Unter¬≠nehmens¬≠netz¬≠werken, die unmit¬≠tel¬≠bar Metho¬≠den der Sozio¬≠logie ver¬≠wen¬≠det und auch die Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz der handeln¬≠den Akteure thematisiert.
Lehr- und lernbar ist das Thema Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz allemal. Es handelt sich um erlern¬≠bare FΟΛhig¬≠kei¬≠ten, nicht um an¬≠gebo¬≠rene Eigen¬≠schaf¬≠ten. Die wich¬≠tigs¬≠ten Kom¬≠ponen¬≠ten der Be¬≠zie¬≠hungs¬≠kompe¬≠tenz kΟΕn¬≠nen ver¬≠mit¬≠telt und trai¬≠niert werden. Denken Sie nur an Kom¬≠muni¬≠kations¬≠fΟΛhig¬≠keiten. Aber auch Prin¬≠zi¬≠pien wie Empa¬≠thie und Rezi¬≠prozi¬≠tΟΛt lassen sich lehren und lernen. NatΟΦrlich gibt es Menschen, denen der gute Um¬≠gang mit ande¬≠ren Men¬≠schen leicht¬≠fΟΛllt, die also ohne wei¬≠tere Aus¬≠bil¬≠dung ΟΦber ein hohes MaΟü an Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz verfΟΦgen. Und es gibt Men¬≠schen, die sich um Um¬≠gang mit ande¬≠ren Men¬≠schen eher schwer¬≠tun und lieber allein sind. Aber das Grund¬≠gerΟΦst der FΟΛhig¬≠kei¬≠ten, die Be¬≠zie¬≠hungs¬≠kompe¬≠tenz aus¬≠ma¬≠chen, ist zwei¬≠fel¬≠los lehr- und lernbar.
Moderne Studien¬≠ange¬≠bote gel¬≠ten hΟΛu¬≠fig als seg¬≠men¬≠tiert, spe¬≠ziali¬≠siert und verschult. Dagegen arbei¬≠ten Sie im Rah¬≠men die¬≠ser Publi¬≠katio¬≠nen mit um¬≠fas¬≠sen¬≠den Themen¬≠stel¬≠lun¬≠gen und bewusst inter¬≠dis¬≠zipli¬≠nΟΛrem Ansatz βÄ™ warum eigentlich?
Aus meiner Sicht brauchen wir viel mehr inter¬≠diszi¬≠pli¬≠nΟΛre Forschung. Das Silo¬≠denken in tradi¬≠tio¬≠nellen Dis¬≠zipli¬≠nen ist ΟΦber¬≠holt. Jedes Fach hat Nach¬≠bar¬≠diszi¬≠pli¬≠nen, ohne deren Ein¬≠bin¬≠dung ein echter Er¬≠kennt¬≠nis¬≠fort¬≠schritt auf Dauer nicht mΟΕg¬≠lich ist. Wir sehen das in Fel¬≠dern wie Behavioral Economics, einer Ver¬≠bin¬≠dung von Psycho¬≠logie und Ο•ko¬≠no¬≠mie, Behavioral Law, wo psycho¬≠logi¬≠sche Er¬≠kennt¬≠nisse Eingang in die Rechts¬≠wissen¬≠schaf¬≠ten gefun¬≠den haben, oder im Be¬≠reich des Nach¬≠hal¬≠tig¬≠keits¬≠manage¬≠ment, das tech¬≠nische, poli¬≠tik¬≠wissen¬≠schaft¬≠liche und ΟΕko¬≠nomi¬≠sche For¬≠schungs¬≠an¬≠sΟΛtze zu¬≠sammen¬≠bringt. In anderen Berei¬≠chen fΟΛngt die inter¬≠diszi¬≠pli¬≠nΟΛre For¬≠schung gerade erst an. Zukunftsthemen wie Fintech und Legaltech erfor¬≠dern eine Inte¬≠gra¬≠tion von IT-Forschung in die tra¬≠ditio¬≠nellen be¬≠triebs¬≠wirt¬≠schaft¬≠lichen und rechts¬≠wissen¬≠schaft¬≠lichen FakultΟΛten.
Ebenso brauchen wir aus meiner Sicht inter¬≠dis¬≠zipli¬≠nΟΛre Stu¬≠dien¬≠gΟΛnge, von denen wir schon jetzt einige sehr inte¬≠ressan¬≠ter haben. Denken Sie nur an FΟΛcher wie Wirt¬≠schafts¬≠inge¬≠nieur¬≠wesen, Ο•kotro¬≠pholo¬≠gie oder Stadt¬≠ent¬≠wick¬≠lung. Die kombinieren alle zwei oder meh¬≠rere Fach¬≠dis¬≠zipli¬≠nen. Die InterdisziplinaritΟΛt er¬≠scheint mir jedoch aus¬≠bau¬≠fΟΛhig. Zudem erscheint es mir wΟΦn¬≠schens¬≠wert, inner¬≠halb ein¬≠zel¬≠nen Fach¬≠studien¬≠gΟΛnge immer auch Social Skills zu ver¬≠mit¬≠teln, um besser auf das Berufs¬≠leben vor¬≠zube¬≠reiten. Dazu gehΟΕrt neben Themen wie Ver¬≠hand¬≠lungs¬≠kompe¬≠tenz oder PrΟΛ¬≠sen¬≠tations¬≠tech¬≠niken eben auch die Be¬≠zieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenz. Ich bin jeden¬≠falls fest davon ΟΦber¬≠zeugt, dass beruf¬≠liche Karrie¬≠ren nicht nur von Fach¬≠kompe¬≠ten¬≠zen abhΟΛn¬≠gen, sondern sehr stark auch von sozia¬≠len Kom¬≠peten¬≠zen. Ab einer gewis¬≠sen FΟΦh¬≠rungs¬≠ebene sind es dann nur noch Bezieh¬≠ungs¬≠kompe¬≠tenzen, ΟΦber das beruf¬≠liche Fort¬≠kommen entscheiden.
Bei mir selbst ist das Inte¬≠resse an inter¬≠diszi¬≠plinΟΛ¬≠ren Themen¬≠stel¬≠lun¬≠gen aus der Er¬≠kennt¬≠nis heraus ent¬≠stan¬≠den, dass die klas¬≠sische BWL wich¬≠tige Aspek¬≠te der Ent¬≠schei¬≠dungs¬≠fin¬≠dung von Indi¬≠vi¬≠duen und Or¬≠gani¬≠satio¬≠nen nicht rich¬≠tig ab¬≠deckt. Neuere Erkenntnisse und rea¬≠litΟΛts¬≠nΟΛhere Modelle kamen hΟΛu¬≠fig aus ande¬≠ren FΟΛchern, ins¬≠beson¬≠dere der Psycho¬≠logie und der Sozio¬≠logie. Als dann im Jahr 2002 mit Daniel Kahneman ein Psycho¬≠loge den Nobel¬≠preis fΟΦr Wirt¬≠schafts¬≠wis¬≠sen¬≠schaften bekam, wurde mir end¬≠gΟΦl¬≠tig klar, dass inter¬≠diszi¬≠pli¬≠nΟΛre An¬≠sΟΛtze einen grΟΕ¬≠Οüeren Er¬≠klΟΛ¬≠rungs¬≠bei¬≠trag lie¬≠fern als die rein fach¬≠be¬≠reichs¬≠spezi¬≠fische Forschung.
Haben Sie vielen Dank fΟΦr das GesprΟΛch!