Im wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Kontext beschreibt Komplexität ganz allgemein eine Situation, in der eine Vielzahl und Vielfalt von teilweise intransparenten und hochgradig interdependenten Faktoren einerseits für eine Komplexitätslast, andererseits aber auch für ein Komplexitätspotenzial sorgen. In diesen schlecht strukturierten, intransparenten und schnell veränderlichen Situationen ist es Aufgabe des Managements, eine Kongruenz von Last und Potenzial herzustellen und auf diesem Weg heuristische Lösungsansätze zu liefern.
Dies gelingt in vielen Konstellationen durch eine aufeinander abgestimmte Vereinfachung der Komplexitätslast und eine Anreicherung der menschlichen und technischen Potenziale zu deren Handhabung. Damit ist das Thema Komplexitätsmanagement wiederum selbst komplex angelegt. Das erforderliche ganzheitliche Know-how für den Umgang mit komplexen Managementsituationen, insbesondere die konzeptionellen Grundlagen sowie die praktischen Anwendungen, vermittelt das Fachbuch „Komplexitätsmanagement. Grundlagen und Anwendungen“.
Wir nehmen dies zum Anlass, mit dem Autor, Professor Dr. Michael Reiss, ein kurzes Gespräch zu führen.
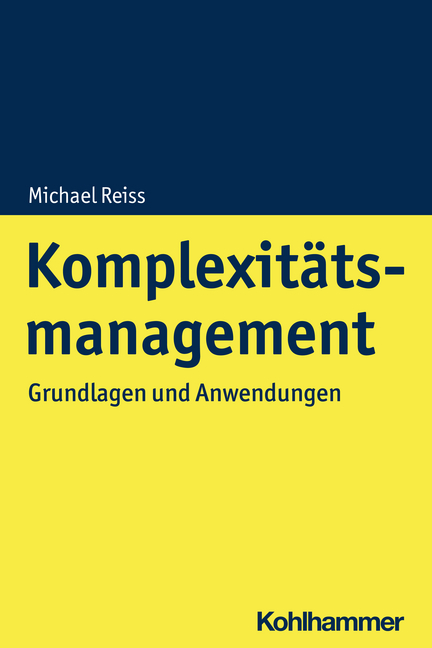 Neu!
Neu!Michael Reiss
Komplexitätsmanagement
Grundlagen und Anwendungen
2020. 220 Seiten. Kart. Ca. € 30,–
ISBN 978-3-17-035593-4
Der Komplexitätsbegriff wird inzwischen infla­tionär gebraucht und es hat sich im Management­kontext fast zur Floskel entwi­ckelt, zunächst auf die wach­sende Komple­xität einer Situa­tion hinzu­weisen. Ist das berech­tigt oder nur eine Mode­erschei­nung?

Alles andere als eine Floskel ist der Verweis auf Komple­xität schlicht deshalb, weil bestimmte reale Entwick­lungen wie z.B. Wachs­tum von Wirt­schafts­leistung und Bevöl­kerung, Inter­natio­nali­sierung, Diversity, Wandel und Volati­lität, vernetz­te statt verket­tete Wert­schöp­fungs­prozesse, Mani­pu­lation von Infor­ma­tionen oder Inno­vations­wett­bewerb in einer gestie­genen Komple­xitäts­last münden. Das gilt auch für Komple­xitäts­anrei­che­rungen bei den Komple­xitäts­poten­zialen, etwa Spei­cher-, Verar­bei­tungs- und Übertra­gungs­kapazi­täten in der Infor­mations­techno­logie oder Tole­ranz und Mehr­sprachig­keit bei den Mitar­beitern.
Den Charak­ter einer Manage­ment-Mode hat der Ver­weis auf Komple­xität hin­gegen dann, wenn „Komple­xität“ losge­löst von inhalt­lichen Erklä­rungs­ansätzen, als Lücken­büßer oder als pau­schale Erklärungs­variable genutzt wird. Dagegen spricht nicht zuletzt die Tat­sache, dass es so etwas wie „die“ Komple­xität gar nicht gibt. Faktisch müssen sich Manager jeweils mit verschie­denen Dimen­sionen und Domä­nen der Komple­xität beschäf­tigen, deren Hand­habung sehr unter­schied­liche Maß­nahmen und Kompe­tenzen erfordert.

Komplex ist also nicht mit kompliziert gleichzusetzen – oder?
„Kompliziertheit versus Komple­xität“ – in der Tat ein Klassi­ker. Allerdings hat es sich gezeigt, dass man mit dieser Diffe­renzie­rung besten­falls eine Sack­gasse ausleuch­tet. Vorhan­dene, teil­weise mehr­deutige Diffe­renzie­rungs­ansätze können nicht über­zeugen: Das gilt zum einen für die Modelle der Demar­kation eines kompli­zierten Kontexts (viele und viel­fältige Elemente, deren Zusammen­wirken bekannt ist) von einem komple­xen Kontext aus teil­weise unbe­kannten Elemen­ten, die in nicht vorher­sag­barer Weise inter­agieren. Das gilt glei­cher­maßen für die Modelle einer Stei­ge­rung, etwa über die Stufen „einfach“, „kompli­ziert“, „komplex“ und „chaotisch“, bei denen echtes Komple­xitäts­manage­ment erst auf einer hohen Schwie­rigkeits­stufe statt­findet. Tat­säch­lich erstreckt sich das Komple­xitäts­management auf mehrere Dimen­sionen der Komple­xität, die durch viele, viel­fältige, unscharf spezi­fizierte und in­trans­parent inter­agie­rende Elemente defi­niert sind. Der Verbund zwischen diesen Dimen­sionen sorgt mit­unter für eine Kumu­lation, etwa wenn („kompli­zierte“) hybride Mischungen von Koope­ration und Konkur­renz („Coope­tition“) zu („komple­xer“) Ambigu­ität und Volati­lität dieser Geschäfts­bezie­hungen führen.
Gibt es allge­meine Erkennt­nisse, die eine Führungs­kraft beher­zigen sollte, um im Sinne des Komple­xitäts­managements effek­tiv zu wirken?
Lange Zeit wurden die Erkennt­nisse zu genau einer Leit­idee verdich­tet, dem Kampf gegen Komple­xität, den Manager nur durch Verein­fachen gewinnen können. Seltener wurde das Kontrast­programm propagiert, etwa die Komple­xitäts­anrei­cherung durch mehr Diver­sität und mehr Wandel. Beide Leit­bilder bergen jedoch das Risiko der Fehl­orien­tierung. Deutlich besser ist die Perfor­mance von Führungs­kräften, wenn sie einem diffe­renzier­ten Leit­bild folgen, bei dem sie einen Aus­gleich von Komple­xitäts­lasten und Komple­xitäts­poten­zialen anstreben. Dafür können sie auf Erkennt­nisse in Gestalt zahl­rei­cher Muster und Proze­duren eines derart aus­gewo­genen Komple­xitäts­managements zurück­greifen, etwa auf eine stufen­weise Umset­zung, auf geschich­teten Wandel oder einen Mix aus Time Pacing und Event Pacing von Inter­ventionen.
Die Digitali­sierung und hier vor allem Big Data und Künst­liche Intel­ligenz werden auch als ein Schlüs­sel für erfolg­reiches Komple­xitäts­manage­ment in der Zukunft ange­sehen – sehen Sie diese Chancen ebenfalls?
Digitalisierung eignet sich zweifel­los als breit­bandig einsetz­bares Poten­zial zur Komple­xitäts­bewäl­tigung. Dennoch handelt es sich aus der Komple­xitäts­perspek­tive dabei nicht um ein All­heil­mittel. Dagegen spricht zunächst die Eigen­komple­xität der Digi­tali­sie­rung, etwa Wider­stände im Gefolge einer digi­talen Spal­tung (der Gesell­schaft) oder der Gefahr einer Total­über­wachung (Big Data = Big Brother). Hinzu kommen zahl­reiche Klärungs­bedarfe, bei­spiels­weise hinsicht­lich des Zusam­men­spiels von mensch­licher und künst­licher Intel­ligenz (z.B. beim auto­nomen Fahren oder bei auto­mati­sier­ten Waffen­sys­temen) und der Perfor­mance, etwa von Kos­ten und Nut­zen eines Inter­nets der Dinge und Dienste. Diese Erklä­rungs­modelle kann das Komple­xitäts­manage­ment allein nicht bieten.
Darüber hinaus muss das Digi­tali­sierungs­manage­ment etwa durch eine Ethik der Künst­lichen Intel­ligenz er­gänzt werden, vor allem durch inhalt­lich spezi­fi­zierte Wert­vorstel­lungen und Regel­infra­struk­turen wie z. B. die EU-Daten­schutz-Grund­verord­nung. Bemer­kens­wert ist in diesem Zusammen­hang, dass zu deren Konzep­tion auch ein Komple­xitäts­ansatz bei­tragen kann, etwa wenn die Wert­vorstel­lungen durch Komple­xitäts­merk­male wie Trans­parenz, Fair­ness (keine Benach­teili­gung speziel­ler Nutzer) und Auf­sicht durch neutrale Dritt­parteien defi­niert werden.
Haben Sie vielen Dank für das Gespräch!
Bleiben Sie auf dem Laufenden –
Abonnieren Sie den Kohlhammer Newsletter