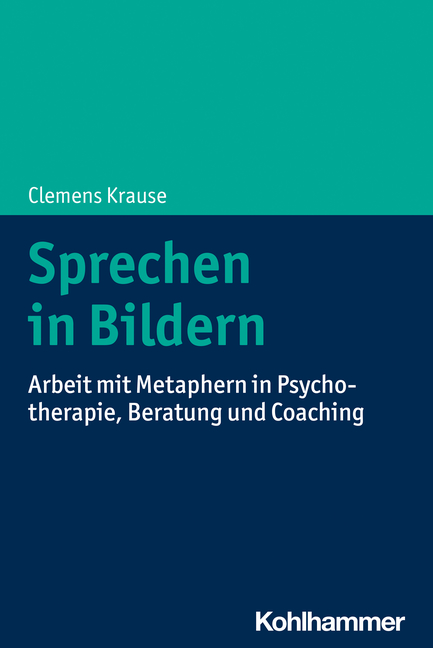Sprechen in Bildern
Mit unserem Autor Clemens Krause sprechen wir über die Bedeutung und Anwendung von Metaphern in der Psychotherapie, Coaching und Beratung. Krause betont, dass Metaphern tief in unser Denken und Fühlen eingebettet sind und aufschlussreiche Einblicke in die Erlebniswelt der Klienten bieten können, was zu effektiveren Therapieansätzen führen kann.

Sie verstehen die Arbeit mit Metaphern nicht als neue Therapiemethode, sondern möchten dazu anregen, stärker auf die bildhafte Sprache der Klientinnen und Klienten zu achten und sich diese in Therapie, Coaching und Beratung zunutze zu machen. Wie dürfen wir uns das vorstellen?
Metaphern sind nicht nur eine Besonderheit der Sprache, sondern wir leben in Metaphern. Diese Annahme geht zurück auf die Metaphertheorie von Lakoff und Johnson, die sie erstmals 1981 in ihrem wegweisenden Buch „Leben in Metaphern“ darstellten. Ich habe mir Gedanken gemacht, wie diese Erkenntnisse Eingang in Psychotherapie, Beratung und Coaching finden können. Metaphern beeinflussen nämlich die Art und Weise, wie wir über einen Sachverhalt nachdenken, welche Emotionen dabei wirksam werden, unsere Einstellungen und welche Handlungsmöglichkeiten wir wahrnehmen. Wenn z. B. ein Klient formuliert „Mein Alltag ist ein großer, steiler Berg. Ich weiß nicht, wie ich ihn bewältigen soll“, so bekommt man als Therapeut, Berater oder Coach einen Eindruck, wie sich das Problem aus Sicht des Klienten darstellt. Er überträgt Eigenschaften von der Quelldomäne Berg auf seinen problematischen Alltag (groß, steil, wirkt nicht zu bewältigen, Ratlosigkeit). Klientengenerierte Metaphern geben somit wertvolle diagnostische Hinweise auf die Erlebenswelt der Klienten. Zum anderen finden sich in solchen Metaphern oft ungenutzte Bereiche, die Ressourcen enthalten und die für eine Veränderungsarbeit genutzt werden können. So gibt es mehrere Möglichkeiten auf einen Berggipfel zu gelangen, was mit dem Klienten dann interaktiv entwickelt werden kann. Eventuell können seine eigenen Erfahrungen mit der Besteigung eines Berges erfragt werden. So ist es möglich, im Gespräch schnell von einer Problem- zu einer Ressourcenorientierung zu kommen und somit zu veränderten Gedanken, Einstellungen, Emotionen hinsichtlich des Problems und optimalerweise auch zu lösungsorientierten Handlungsstrategien, die vorher nicht bewusst wahrgenommen wurden.
Worin unterscheiden sich patienten- von therapeutengenerierten Metaphern und welche Effekte lösen sie aus?
Patientengenerierte Metaphern werden im Gespräch von Patienten formuliert. Bedeutsam sind diese, wenn sie sich z. B. selbst damit beschreiben, das soziale Umfeld oder ihre Problemsicht. Greift der Therapeut dann so eine Metapher auf, exploriert er sie gemeinsam mit seinem Gegenüber, setzt er direkt am Erleben des Patienten an. Er holt den Patienten ab und spricht die gleiche Sprache. Das fördert natürlich die Beziehung. Der Patient fühlt sich verstanden und ernst genommen. Der Therapeut hat zudem durch die Beachtung patientengenerierter Metaphern einen diagnostischen Mehrwert. Tatsächlich scheint es so zu sein, dass in erfolgreichen Therapien der Anteil der von Patient und Therapeut gemeinsam genutzten Metaphern höher ist.
Mit Hilfe von therapeutengenerierten Metaphern kann der Therapeut dagegen unmittelbar seine Sicht der Dinge vermitteln und so einen Perspektivwechsel oder ein Reframing des Problems anregen. Nutzt er Metaphern, deren Träger Geschichten sein können, kann er Reaktanz und Widerstände beim Patienten umgehen. Therapeutengenerierte Metaphern sind zudem unverzichtbar, um Patienten abstrakte theoretische Konzepte anschaulich zu vermitteln und somit begreifbar zu machen. Ein weiterer Vorteil, den die Arbeit mit Metaphern bietet, ist, dass Metaphern besser erinnert werden, da bei ihrer Kodierung verbal assoziative Prozesse, bildliche Vorstellung und emotionale Prozesse wirksam werden, die zu einer tieferen Verarbeitung im Gedächtnis beitragen. Das gilt dann für beide Formen des Metaphergebrauchs.
Welche Herausforderungen gibt es bei der Arbeit mit patientengenerierten Metaphern und worauf ist besonders zu achten?
Lassen Sie mich diese Frage metaphorisch beantworten. Sie befinden sich mit Ihrem Gegenüber in einem Boot, das auf dem Gesprächsfluss mit der Strömung treibt. Mal gibt es ruhigere Phasen, in denen das Boot langsam und träge dahingleitet, mal wird der Strom reißender. Ihre Aufgabe ist es, das Boot im Gesprächsfluss zu steuern und zu manövrieren, möglichst zu verhindern, dass es kentert oder an einem Felsen leckschlägt. Das erfordert eine gewisse Konzentration, Aufmerksamkeit und Expertise. Es bedarf nun einer besonderen, zusätzlichen Achtsamkeit, auch den Grund des Flusses im Auge zu behalten. Ab und zu glitzert dort nämlich ein Edelstein auf. Den können Sie nur ergreifen, wenn Sie ihn auch bemerken. Nicht jeden Edelstein auf dem Grund des Flusses werden Sie heben, manchmal ist die Strömung einfach zu stark, der Fluss zu tief oder das Wasser zu trübe. Und mancher Stein, der auf dem Grund des Flusses blinkt, erweist sich nach dem Herausholen als einfacher Kieselstein, den Sie dem Fluss zurückgeben können. Wenn Sie jedoch einmal einen Edelstein erwischt haben, dann können Sie ihn gemeinsam mit Ihrem Gegenüber betrachten und bestimmen, herausfinden, was er Ihrem Gegenüber bedeutet. Es ist zunächst ein gemeinsamer Wert, auf den Sie beide achtgeben. Der Stein kann gemeinsam bearbeitet und geschliffen werden. Die Form des Steins und die Art und Weise, wie er das Licht bricht, wird sich dadurch womöglich verändern und am Ende der Bootsfahrt kann Ihr Gegenüber diesen Stein mit nach Hause nehmen und manchmal hat die Bootsfahrt, der Fund und die Bearbeitung des Edelsteins ihn verändert und es kann sich noch lange an dem Juwel erfreuen.
Wichtig ist zudem als Therapeut, Berater oder Coach, nicht davon auszugehen bei einer Metapher sofort zu wissen, was das Gegenüber von der Quelldomäne auf das Problem überträgt. Es ist unerlässlich, gemeinsam das Bild der Metapher zu explorieren und kognitive, emotionale, physiologische Aspekte sowie Handlungsentwürfe herauszuarbeiten. In einem nächsten Schritt können dann gemeinsam Ressourcen in der Metapher gesucht werden, welche der Patient bisher nicht erkannt hat und auf das Problem übertragen werden. Finden sich in der ursprünglichen Metapher keine Ressourcen, kann ein Metapherwechsel angeregt werden. Der Prozess der Exploration und der Ressourcensuche erfolgt mit der Methode der Imagination.
Neben Metaphern bringen Sie auch Geschichten oder Anekdoten in die Therapie, das Coaching ein. Wo sind die Unterschiede?
Geschichten und Anekdoten sind keine Metaphern per se, sondern Erzählformen. Geschichten können jedoch Metaphern auf unterschiedlichen Ebenen enthalten. Das Erzählen von Geschichten ist zentral in der Evolution der Menschheit und Geschichten sind somit ein Speicher der Kultur. Werte und Normen werden durch sie übermittelt und an die nächste Generation weitergegeben. Deshalb ist es nicht überraschend, dass Geschichten auch in der professionellen Arbeit mit Menschen eine Rolle spielen. Geschichten sind permissiver als direkte Instruktionen und können mehrdeutig interpretiert werden. So können Veränderungsvorschläge des Therapeuten elegant verpackt werden. Der Patient hört die Geschichte und erhält die Freiheit sich das auswählen und auf sein Problem übertragen, was ihn anspricht und kann den Rest ignorieren. Das ist dann wenig konfrontativ und Widerstände können umgangen werden.
Anekdoten geben eine besondere oder charakteristische Begebenheit im Leben einer Person wieder, die aufs wesentliche reduziert ist und eine Pointe erhält. Ich nutze oft authentische Geschichten aus meinem persönlichen Erfahrungsbereich, z. B. aus anderen Therapien oder Coachings. Anekdoten schaffen einen schnellen Zugang zum Erfahrungsbereich des Patienten oder Klienten indem sie direkt an seinen Themen anknüpfen, wodurch das Erzählte nachvollziehbar wird und gut auf eigene Erfahrungen übertragbar ist.
Metaphern werden im Allgemeinen im Bereich der sprachlichen Kommunikation verortet. Was sind Handlungsmetaphern?
In der therapeutischen oder beraterischen Kommunikation spielen sich Metaphern auf einer mentalen Ebene ab. Durch das Übertragen von gewissen Merkmalen einer Quelldomäne auf eine Zieldomäne, die im therapeutischen Bereich oft eine problematische Situation des Patienten darstellt, wird das Problem in Begriffen der Quelldomäne beschrieben. Handlungsmetaphern spielen sich nicht nur auf der mentalen Ebene ab, es erfolgt vielmehr eine Inszenierung der Metapher. Viele Therapieverfahren folgen diesem Prinzip, obwohl der metaphorische Prozess als Wirkvariable selten explizit genannt wird. Meiner Meinung nach spielt die Metapher in der Kunst- und Gestaltungstherapie, der Musiktherapie, der Bewegungstherapie, der Hippotherapie und anderen handlungsorientierten Therapieverfahren eine wichtige Rolle. So werden vom Patienten gemalte Bilder im Hinblick auf deren Lebenssituation übertragen und gedeutet. Eine Familienaufstellung kann ebenfalls als Metapher gesehen werden. Die Aufstellung steht für die problematische Situation des Patienten und sie kann die Struktur seines Familiensystems metaphorisch mit Stellvertretern darstellen. Der Abstand und der Blickkontakt der Stellvertreter sind Ausdruck der Beziehungen von Personen im System des Patienten und sie können ihre Eindrücke und Empfindungen mitteilen. Der Patient überträgt schließlich die Erkenntnisse aus dieser Aufstellung auf sein reales Beziehungsgeflecht und kann dieses dadurch in einem neuen Licht sehen. Auch das Psychodrama nutzt szenische Elemente metaphorisch, indem der Protagonist einen Raum, eine Bühne bekommt und dabei die Erlaubnis erhält, seine Lebensgeschichte oder Aspekte davon in Szene zu setzen, wobei er andere Mitglieder der Gruppe auf die Bühne holen kann. So können metaphorisch Wünsche, Phantasien oder Probleme dargestellt werden.
Sie bezeichnen Metaphern als Suggestionen. Was hat es damit auf sich?
Im Falle einer Suggestion beeinflusst eine Person eine andere über verbale oder non-verbale Kommunikation und/oder Kontextfaktoren. Die Beeinflussung kann willentlich oder unwillentlich erfolgen in einer Weise, dass diese Person Intentionen, Überzeugungen, Gefühle oder Wünsche des Suggestors übernimmt. Die Beeinflussung muss dabei auf der automatischen Aktivierung von Bedeutungsstrukturen beruhen, so dass sich der Suggestand einer Beeinflussung nicht bewusst ist. Beim Rezipieren von Metaphern werden Konzepte automatisch aktiviert und Prozesse der Übertragung, aber auch Hemmung der Übertragung von Merkmalen der Quelldomäne auf die Zieldomäne vollziehen sich außerhalb der bewussten Kontrolle. So kommt es dann, dass eine Metapher wie die Flüchtlingsflut, Eigenschaften, die mit der Quelldomäne Flut verbunden werden (Ängste um das eigene Leben oder den Verlust von Besitz, das Gefühl von Bedrohung und eigener Hilflosigkeit, der Handlungsimpuls, sich vor der Flut zu schützen, etwa durch den Bau von Dämmen, welche die Flut abhalten), auf die Zieldomäne, den Zuzug von Flüchtlingen, überträgt. In diesem Beispiel sind das vor allem emotionale Komponenten, aber der Handlungsimpuls, sich durch Dämme vor der Flut zu schützen, findet seine Entsprechung im Bau von Grenzzäunen, um Flüchtlinge vom Zuzug abzuhalten, wie es beispielsweise in Ungarn, Polen und den USA bereits geschehen ist. Natürlich können wir einer Metapher bewusste Aufmerksamkeit zuwenden und sie analysieren, aber selbst dann können wir den metaphorischen Prozess nicht verhindern. Der suggestive Aspekt der Metapher kann in Therapie, Beratung und Coaching genutzt werden, allerdings unter einem ethischen Gesichtspunkt, im Sinne von gemeinsam formulierten Veränderungszielen.
Herzlichen Dank für Ihre Zeit und Ihre Mühe!
Clemens Krause
Sprechen in Bildern
Arbeit mit Metaphern in Psychotherapie, Beratung und Coaching
2023. 168 Seiten mit 7 Abb. und 8 Tab. Kart.
€ 34,–
ISBN 978-3-17-040700-8