
Lehrbuch Soziale Arbeit

Zu Beginn des Studiums ist vor allem eines gefragt: Orientierung. Und Orientierung für das Studium der Sozialen Arbeit bietet unser neues großes Lehrbuch aus der Reihe Grundwissen Soziale Arbeit. Wie dieses Buch den Studieneinstieg erleichtern kann und warum es Studierende über ihr gesamtes Studium hinweg bis ins Berufsleben begleiten sollte, erklärt Mitherausgeber Heiko Löwenstein im Interview.
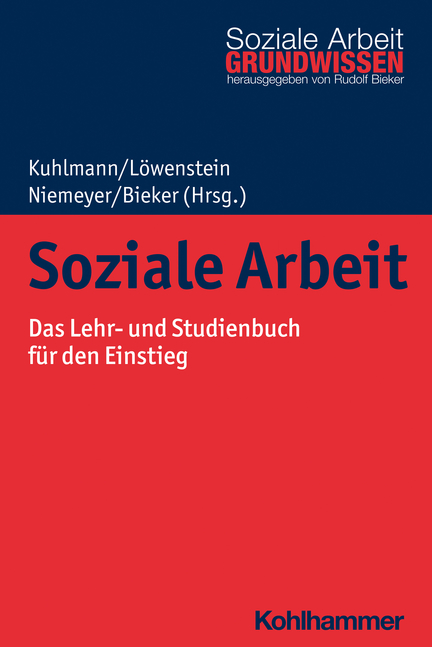
Kuhlmann/Löwenstein/Niemeyer/Bieker (Hrsg.)
Soziale Arbeit
Das Lehr- und Studienbuch für den Einstieg
2022. 268 Seiten. Kart. € 34,–
ISBN 978-3-17-039266-3
Grundwissen Soziale Arbeit
Einführende Lehrbücher zur Sozialen Arbeit gibt es viele. Was ist das Besondere an Ihrer Einführung?
Da würde ich vor allem drei Besonderheiten sehen. Erstens hatten wir den Wunsch nach einem Lehrbuch, das Studierende als allererstes in die Hand nehmen möchten und das sie von da an durch das gesamte Studium begleitet. Denn mit seiner Hilfe soll wichtiges Grundwissen der gesamten Fachwissenschaft Soziale Arbeit mit rechtlichen und organisationalen Grundlagen im Selbststudium niedrigschwellig erarbeitet werden können. Das bedeutete für uns am Anfang zunächst ein ziemliches Problem: nämlich, dass das Buch eine kaum mehr zu überblickende Breite an Grundlagen abdecken soll, dabei aber kompakt bleiben muss und auch leicht verständlich sein sollte. Wir kamen dann bald auf die Idee, uns in der Erarbeitung auf solche Entwicklungslinien zu fokussieren, die sich durch alle Bereiche des skizzierten Grundwissens nachzeichnen lassen: die sowohl geschichtlich als auch wissenschaftlich, methodisch, rechtlich und strukturell sichtbar werden.
Das Ergebnis, meine ich, ist dann nicht nur sehr synergetisch und effizient in der Textmenge, sondern beinhaltet auch etwas, was ich als zweite und vielleicht die wichtigste Besonderheit ansehen würde: dass dadurch nämlich deutlich wird, wie Geschichte, Wissenschaft, Methoden und Rahmenbedingungen Sozialer Arbeit, die sonst eher unverbunden erarbeitet werden, in Wirklichkeit ganz eng zusammenhängen – wie also Handeln, wenn es Methode sein soll, auf wissenschaftlichem Wissen basiert, und dass es dazu auch einer fachlichen Begründung und rechtlicher Ansprüche bedarf. Das Ganze ist dann sowohl in seinem aktuellen Kontext zu sehen, mit den Beschäftigungsverhältnissen und Arbeitsbedingungen, die Soziale Arbeit unterstützen sollten, als auch im historischen Kontext, um Entwicklungen kritisch reflektieren zu können. Damit das gelingen konnte, mussten wir uns als Autor*innen eng abstimmen.
Und da wären wir drittens bei einer für mich persönlich ganz wichtigen Besonderheit: nämlich dass sieben unterschiedliche Autor*innen es geschafft haben, nicht nur ihre ganz spezifischen Expertisen zu Geschichte, Wissenschaft, Methoden, Recht und Arbeitsverhältnissen zusammenzutragen, sondern sie als wirkliches Autorenteam auch so aufzubereiten, dass ein stimmiges Ganzes entsteht. Und auch wenn das andere Lehrbücher zur Sozialen Arbeit ebenso leisten sollen: Ich glaube, die didaktische Umsetzung mit Ausblicken auf die Lernziele zu Beginn jedes Kapitels, mit Zusammenfassungen des Wichtigsten am Ende, mit liebevoll gestalteten Abbildungen, die schon möglichst intuitiv wirken sollen, und anderen methodischen Elementen, hat uns allen wirklich besonders viel Spaß gemacht. Wir hatten richtig große Lust auf ein konsequentes Lehrbuch. Und die Unterstützung des Schriftenreihenherausgebers, der bei diesem Buch sogar als Autor mitbeteiligt war, hat uns unglaublich dabei geholfen.
Sie versprechen Orientierung für das Studium der Sozialen Arbeit. Wie hilft Ihr Buch dabei?
Durch die jeweils sehr kompakt gehaltenen Einführungen in Geschichte, Wissenschaft, methodisches Handeln, Recht und Arbeitsverhältnisse geben wir erstens in dem Sinne Orientierung, dass wir jeweils einen sehr schnellen und niedrigschwelligen Ersteinstieg ermöglichen wollen. Wir erarbeiten ein absolutes Grundverständnis und geben Hinweise zum Weiterlesen. Das Buch soll sich unserer Idee nach auch im Selbststudium lesen lassen. Es bedarf also keines Seminars, für das es lediglich als veranstaltungsbegleitende Lektüre empfohlen wird, um nochmals etwas nachzulesen, was aber im Grunde schon erklärt wurde. Stattdessen könnte ich es sogar zur komprimierten Vorbereitung empfehlen: für BA-Studierende kapitelweise vor den jeweiligen Seminarveranstaltungen, um von der Präsenz mit ihren Lehrenden mehr zu profitieren, aber auch für MA-Studierende mit fachfremdem/ fachverwandtem Bachelor – z. B. Erziehungswissenschaften, Heil- oder Kindheitspädagogik – , um sich schnell in der Sozialen Arbeit zu orientieren, oder vielleicht sogar schon für Studieninteressierte, um einschätzen zu können, was sie in der Sozialen Arbeit erwartet und womit man sich im Studium schwerpunktmäßig befassen wird. Zweitens schaffen wir dadurch Orientierung, dass wir die unterschiedlichen Grundlagen jeweils zu Geschichte, Wissenschaft, methodischem Handeln, Recht und Arbeitsbedingungen, die in anderen Lehrbüchern und auch im Studium eher getrennt voneinander behandelt werden, systematischer aufeinander beziehen. Das schafft Orientierung im Sinne eines Verständnisses von Zusammenhängen. Das heißt also, auch wer diese Grundlagen schon kennt, kann das Buch dazu nutzen, das alles einmal zusammenzudenken, miteinander zu verbinden und Studieninhalte nachträglich zu verzahnen.
Ein eigenes Kapitel ist den Methoden der Sozialen Arbeit gewidmet. Was können Studierende und Lehrende hier erwarten?
Genau genommen sprechen Anne van Rießen und Michael Fehlau ja nicht von Methoden, sondern von methodischem Handeln. Als Leser*in kann man daher schon gleich ein weit gefasstes Methodenverständnis erwarten: Zwar wird ein Grundverständnis von etablierten Methoden erarbeitet – z. B. von unterschiedlichen Beratungsansätzen, Case Management, sozialer Netzwerkarbeit oder Sozialplanung usw. Methoden sind aber mehr als das, wo Methode draufsteht; auch lebensweltliche Praxis, z. B. der gemeinsame Spaziergang oder die Bandprobe im Jugendzentrum, das kann Methode sein, wenn dadurch Ziele Sozialer Arbeit erreicht werden sollen, wenn den ethischen Maßstäben der Profession entsprochen wird und wenn eine wissenschaftliche Fundierung erfolgt. Und auch das, was man als Methoden Sozialer Arbeit kennt, ist nicht schon einfach gebrauchsfertig, sondern auf die spezifischen Situationen mit ihren institutionellen Rahmenbedingungen abzustimmen. Jenem Abstimmungsprozess wird als partizipativer Praxis in diesem Kapitel ganz besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Und damit das mit wissenschaftlichem Knowhow erfolgt, kam uns einmal mehr entgegen, dass wir wissenschaftliche und methodische Grundlagen hier in einem Band zusammenhaben und daher auch systematischer aufeinander beziehen können. Zudem wird ein Bogen von der Geschichte Sozialer Arbeit bis zum Stand der aktuellen Methodendiskussion gespannt: Die klassische Trias von Einzelfallhilfe, Gruppenarbeit und Sozialraumorientierung zu kennen, ist zwar wichtig, um zu verstehen, wie es zu den heutigen Schwerpunkten methodischen Handelns in den Handlungsfeldern Sozialer Arbeit kam. Dass diese Teilung heute und für die Zukunft aber immer weniger Sinn macht, wird am Beispiel der Digitalisierung verdeutlicht und ein alternativer Ordnungsversuch wird entfaltet.
Am Ende Ihres Buches widmen Sie sich mit dem Thema der Beschäftigungsbedingungen in dem Berufsfeld Soziale Arbeit. Warum sollten sich Studierende bereits zu Beginn Ihres Studiums damit auseinandersetzen?
Soziale Arbeit ist immer nur so gut, wie die Rahmenbedingungen, unter denen sie stattfindet. Daher ist es nicht nur gesunder Eigennutz, die eigenen Rechte als Arbeitnehmer*in zu kennen und dafür Sorge zu tragen, dass man förderliche Arbeitsbedingungen vorfindet. Absolvent*innen sollten auch wissen, wie sie die Bedingungen ihrer Praxis über betriebliche Mitbestimmung förderlich gestalten können. So werden überhaupt erst die notwendigen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass man sich auf die eigene, sehr anspruchsvolle Arbeit konzentrieren kann. Und diese Tätigkeit sollte dann auch angemessen entlohnt werden, damit sie für hoch qualifizierte Kolleg*innen attraktiv bleibt bzw. noch an Attraktivität gewinnt und damit die richtigen Anreize für Weiterqualifizierungen gesetzt werden. Man muss wissen, dass sich Arbeitsverhältnisse im Öffentlichen Dienst, bei freien Trägern der Wohlfahrtspflege und bei den Kirchen deutlich voneinander unterscheiden können, z.B. hinsichtlich Tarifbindung, Beschäftigungssicherheit und Entgelten. Wer sich damit frühzeitig beschäftigt, hat Vorteile, um am Ende die richtige Wahl für sich zu treffen.
Dr. Heiko Löwenstein ist Professor für Theorien, Konzepte und Methoden der Sozialen Arbeit mit Schwerpunkt Inklusion an der Katholischen Hochschule NRW und Mitherausgeber des Lehrbuchs Soziale Arbeit.