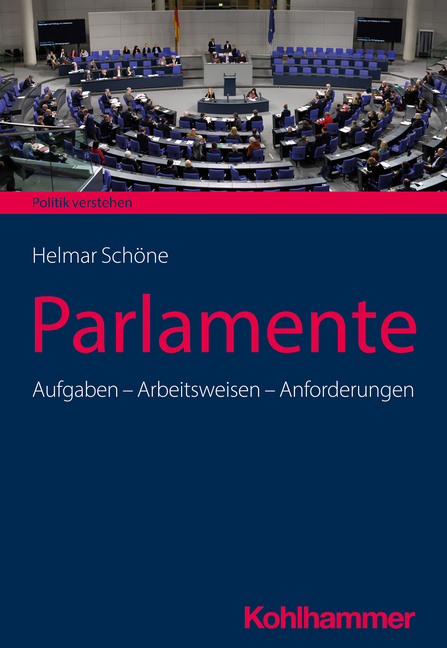Parlamente –
Grundpfeiler der Demokratie
Am 29. Oktober 1923 rief Mustafa Kemal Pascha („Atatürk“) die laizistische Republik Türkei aus. Die Republik kann heute also mit Unterbrechungen auf über hundert Jahre teilweise turbulenter Geschichte zurückblicken. Seitdem Recep Tayyip Erdoğan die Geschicke des Landes maßgeblich bestimmt, wurden jedoch die Kompetenzen des Parlaments de jure und de facto schrittweise beschnitten. Die Verfassungsänderung im Jahr 2018 war insofern ein weiterer Schritt in Richtung autoritäres Regime und wurde daher von EU, Europarat und OSZE zu Recht kritisiert. Ist das die große Ausnahme, oder handelt es sich um einen Trend?
Autokratien vs. Demokratien: Globale Trends
Die Bertelsmann Stiftung untersucht Jahr für Jahr rund 140 Staaten: 63 Demokratien stehen 74 Autokratien gegenüber, wobei in 83 Ländern eine starke soziale Ausgrenzung zu beobachten ist. Das alles wirkt sich negativ auf die globale Wirtschaft aus, die einen neuen Tiefststand erreicht habe. (Quelle: www.bti-project.org)
Trotz Stimmen wie bspw. Wolfgang Merkel, dem die Rede von einer „Krise der Demokratie“ zu vereinfachend und zu alarmistisch ist, geben allein diese Zahlen durchaus Anlass zur Beunruhigung.
Denn ähnliche Entwicklungen lassen sich in ganz unterschiedlichem Ausmaß beobachten; es scheint also tatsächlich ein breites Phänomen zu sein, das sich schleichend entwickelt. Einige Länder wie u. a. Türkei, Algerien, Irak oder Jordanien gelten daher nach dem Transformationsindex der Bertelsmann Stiftung heute als „moderate“ Autokratien. Andere wie Russland, Myanmar oder China müssen sogar als „Hardliner-Autokratien“ bezeichnet werden. Daneben macht die Studie auch „defekte“ Demokratien aus. Dazu gehören bspw. Indien, Ungarn und Rumänien.
Dass der Parlamentarismus zunehmend unter Druck gerät, wird nicht nur anhand konkreter Einzelfälle greifbar. Diese Entwicklung wird durch die Zahlen von mehreren jährlich durchgeführten empirischen Studien wie dem EIU-Demokratie-Index bestätigt. Anhand von fünf Kategorien (Wahlverfahren, Pluralismus, Funktionsweise der Regierung, politische Beteiligung, politische Kultur und bürgerliche Freiheit) versucht dieser, die Entwicklung der Demokratien abstrakt zu beziffern. Dieser Koeffizient hat sich seit Anfang der 2000er Jahre beständig verschlechtert – in den letzten Jahren mit wachsender Geschwindigkeit.

Wie kommt es zu dieser beunruhigenden Entwicklung
und wie kann man ihr begegnen?
Die Gründe sind vielfältiger Natur. Man kann sie aber unter einem gemeinsamen Schirm zusammenfassen:
Demokratie ist kein Selbstläufer, sondern erfordert den permanenten Einsatz einer gesellschaftlichen Mehrheit. Fällt dieser Einsatz dauerhaft weg, steigt die Wahrscheinlichkeit, dass der Parlamentarismus durch ein autoritäres System ersetzt wird.
Und was kann man als Individuum dagegen unternehmen? Viel und ganz unterschiedliche Dinge. An erster Stelle steht jedoch eine gründliche Information und politische Bildung. Demokratien können gerade in Zeiten von Fake News und KI‑generierten Echokammern im Netz nicht funktionieren, wenn die Gesellschaft sich nicht fundiert mit Politik und ihren Institutionen beschäftigt.
Besonders Parlamente werden im Netz häufig attackiert: als Orte von Parteiengezänk statt Sachorientierung, von Lobbyismus statt Bürgernähe, die immer größer und deshalb teurer werden und in denen „die da oben“ auch noch selbst über ihre Bezahlung bestimmen … Einige solcher Vorwürfe beruhen aber eher auf Missverständnissen der Funktion und Arbeitsweise eines Parlaments.
Zeit also, sich mit diesem Thema eingehend zu beschäftigen.
Pünktlich zur Europawahl und den im Herbst anstehenden Landtagswahlen gibt Prof. Dr. Helmar Schöne in seinem Buch „Parlamentarismus“ am Beispiel des Deutschen Bundestages einen Einblick in die Alltagsarbeit von Abgeordneten und wirft einen Blick hinter die Kulissen der wichtigsten Parlamentsgremien, ihren Aufgaben und Arbeitsweisen.
Wissenschaftspreis des Deutschen Bundestages 2025
Und für all die AutorInnen aus dem Bereich der politischen Bildung: Sie können durch Publikationen noch mehr bewegen.
Der Deutsche Bundestag honoriert diese Bemühungen durch den Wissenschaftspreis, der im Jahr 2025 an herausragende wissenschaftliche Arbeiten zum Thema Parlamentarismus vergeben wird.
Alles Wissenswerte zur Vergabe des Preises finden Sie auf der Seite des Deutschen Bundestages.
Den Artikel verfasste Dr. Peter Kritzinger aus dem Lektorat Geschichte/Politik.
Bildnachweis: studio v-zwoelf – stock.adobe.com
Helmar Schöne
Parlamente
Aufgaben – Arbeitsweisen – Anforderungen
2024. 177 Seiten mit 20 Abb. und 5 Tab. Kart.
€ 28,–
ISBN 978-3-17-034559-1
Aus der Reihe: Politik verstehen