
Sophia Bock und Wilfried Schubarth liefern Basiswissen zu Verschwörungstheorien

Verschwörungsmythen können das gesellschaftliche Zusammenleben gefährden. Das gilt nicht nur für die Politik, das gilt auch und ganz besonders für die Schule. Wie mit Verschwörungsmythen in der Schule umgegangen werden sollte und welche Rolle in den aktuellen Debatten das Internet spielt, das erklären Sophia Bock und Wilfried Schubarth im Interview.
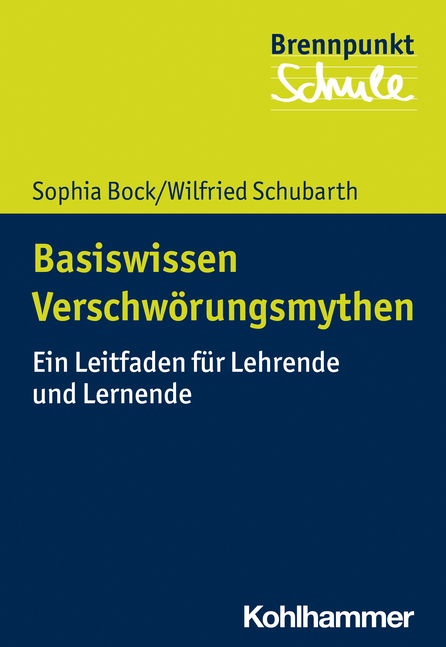 Neu!
Neu!Sophia Bock/Wilfried Schubarth
Basiswissen Verschwörungsmythen
Ein Leitfaden für Lehrende und Lernende
2021. 208 Seiten. Kart. € 29,–
ISBN 978-3-17-041246-0
Warum sind Verschwörungsmythen ein Thema für Schulen?
Wilfried Schubarth: Verschwörungsmythen machen vor Schule nicht Halt. Wie bei den Erwachsenen sind auch ca. ein Drittel der Jugendlichen anfällig für Verschwörungserzählungen, egal ob es die Corona-Pandemie, die Medien oder die Politik betrifft. Die allgemeine Hilflosigkeit, dagegen etwas zu unternehmen, gerade im Bildungsbereich, war Anlass dieses Buch zu schreiben.
Wo genau beginnt das Verschwörungsdenken? Misstrauen, Kritik sind doch auch etwas Positives.
Sophia Bock: Grundsätzlich ja, aber Verschwörungsgläubige gehen bei ihrer Kritik undifferenziert davon aus, dass alles von einer einzigen Gruppe zu einem ganz bestimmten Zweck absichtlich und mit bösartigen Hintergedanken geplant wurde. Natürlich gibt es da auch Graubereiche, aber genau bei diesen Zuschreibungen, die oft ohne konkrete Belege geäußert werden, sollte man schon hellhörig werden – und zum Beispiel genau nach der Herkunft der Informationen fragen.
Und wie erklärt sich die Anfälligkeit gegenüber Verschwörungserzählungen?
Sophia Bock: Im Allgemeinen ist jeder und jede für den Glauben an Verschwörungserzählungen anfällig, da sie ein tiefes Grundbedürfnis erfüllen, Dinge zu erklären und einzuordnen. Denn genau das ermöglichen Verschwörungserzählungen: Sie stellen gerade in Krisenzeiten eine Bewältigungsstrategie dar, indem sie einfache Erklärungs- und Deutungsangebote machen. Schuldige lassen sich identifizieren, verloren geglaubte Handlungsmacht lässt sich zurückgewinnen und man erlebt (wieder) Selbstwirksamkeit und Entlastung. Leider verkehrt sich das aber auch oft in eine Richtung gegen „die da oben“, mit der mitunter auch Gewalt legitimiert wird.
Wilfried Schubarth: Zugespitzt gesagt: Hasserfüllte rückwärtsgewandte Narrative, die an die Stelle bisheriger Fortschrittserzählungen treten, treffen auf generelles Misstrauen und mangelnde Medienkompetenz, was zu einem gefährlichen Gemisch werden kann.
Wie kann dem „Querdenken“ entgegengearbeitet werden?
Sophia Bock: Mit „Geradeausdenken“, für das wir eine Orientierungshilfe in der gegenwärtigen „Infodemie“ geben. Hierzu wählen wir ein modulares Vorgehen: Sensibilisierung, Aufklärung, Digitale Prävention. Verschwörungserzählungen sind nichts Neues und so haben wir neben der Erklärung, wie und warum Verschwörungsmythen wirken, den Fokus auch auf historische Ansätze gelegt, denn Altes erscheint lediglich in neuem Gewand. Dies in der gegenwärtigen „Informationsflut“ zu erkennen und Fakten von Verschwörungsmythen zu unterschieden, ist sowohl individuell, aber auch für die gesamte Gesellschaft eine riesige Herausforderung.
Wilfried Schubarth: Letztlich wollen wir mit dem Buch eine Debatte anstoßen, um Bildung im digitalen Zeitalter neu zu denken. Angesichts der Bedrohungen brauchen wir mehr digitale und politische (Medien-)Kompetenz.
Sophia Bock promoviert nach ihrem abgeschlossenen Lehramtsstudium an der Universität Potsdam zum Thema Verschwörungsideologien als Herausforderung für Schulen und Lehrkräfte. Prof. Dr. Wilfried Schubarth lehrte bis zu seiner Emeritierung (2021) am Department Erziehungswissenschaft der Universität Potsdam zu Fragen der Jugend-, Schul- und Bildungsforschung.