
Formen des Rassismus und Intervention
Rassismus ist noch immer ein großes Problem – und das weltweit. Welche Formen von Rassismus es gibt und was jeder und jede Einzelne dagegen tun kann, das erklärt unser Autor Wolfram Stender im Interview.
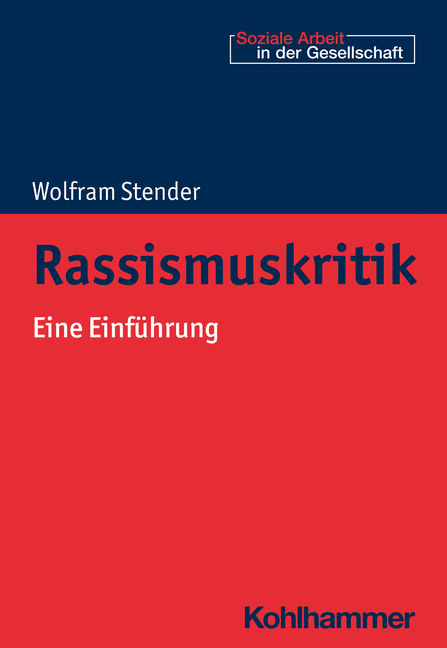
Wolfram Stender
Rassismuskritik
Eine Einführung
2023. 208 Seiten. Kartoniert. € 36,–
ISBN 978-3-17-036704-3
Reihe: Soziale Arbeit in der Gesellschaft
Herr Stender, warum brauchen wir eine Einführung in die Rassismuskritik?
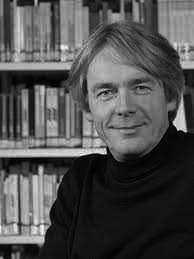
Weil Anspruch und Wirklichkeit so weit auseinanderklaffen. Zwar haben fast alle Staaten der Welt die Antirassismuskonvention der UN unterzeichnet und sich damit verpflichtet, Rassismus in jeder Form zu bekämpfen. Dennoch gibt es auch heute noch überall auf der Welt Rassismus. Dabei sind rassistisch motivierte Gewalttaten nur die Spitze des Eisbergs. Das ganze Ausmaß wird erst sichtbar, wenn man die Perspektiven derjenigen zur Kenntnis nimmt, die Rassismus alltäglich am eigenen Leib erfahren. Um Rassismus erfolgreich zu bekämpfen, müssen wir wissen, wie er funktioniert und welche Funktionen er hat.
Wie unterscheiden sich „Alltagsrassismus“, „Institutioneller Rassismus“ und „Struktureller Rassismus“?
Formen der Degradierung, der Ausgrenzung, der Einschüchterung, der Beleidigung, der Inferiorisierung, der Bevormundung, der Nichtanerkennung, der Pathologisierung usw. gehören zum Alltag der Menschen, die Zielscheibe von Rassismus sind. Darauf bezieht sich der Begriff des „Alltagsrassismus“. Diese Formen sind aber auch in Verfahren, Normen und Regeln, Routinen und Handlungslogiken von Institutionen ‚eingebaut‘. Darauf zielt der Begriff des „Institutionellen Rassismus“. Und schließlich stellt Rassismus auch eine Struktur sozialer Ungleichheit dar, die sich in den Sozialstrukturdaten nachweisen lässt. Dies wird im Begriff des „Strukturellen Rassismus“ reflektiert.
Was bedeutet es, rassismuskritisch zu denken und zu handeln?
Da Rassismus ein gesellschaftliches Verhältnis ist, kann es kein Außerhalb des Rassismus geben. Ich selbst bin Teil der Struktur, die ich in meinem Alltagshandeln reproduziere. Aber ich kann die Struktur auch hinterfragen. Rassismuskritische Reflexivität bedeutet dann zum Beispiel, dass ich die Mechanismen der Normalisierung von Rassismus in der Institution, in der ich arbeite, zum Thema mache und auch zum Gegenstand der Veränderung – das wäre in meinem Fall die Hochschule, die ja noch immer sehr weitgehend ein weißer Raum ist.
Sie wenden sich in einem Kapitel Ihres Buches direkt an Sozialarbeitende und solche, die es werden wollen. Wer kann noch von Ihrer Einführung in die Rassismuskritik profitieren?
Rassismuskritische Reflexivität ist grundlegend für alle Handlungsfelder der Sozialen Arbeit, aber auch für alle sonstigen pädagogischen Berufe. Der „Schlüssel zur Veränderung“ – so hat es die Erziehungswissenschaftlerin Astrid Messerschmidt einmal formuliert – liegt in der Bereitschaft, den alltäglichen Rassismus nicht zu externalisieren, sondern die rassismuskritische Perspektive mit der eigenen beruflichen Tätigkeit zu verbinden und zu einem konstitutiven Element pädagogischer Professionalisierung zu machen.
Dr. Wolfram Stender ist Professor für Soziologie an der Hochschule Hannover.