
Die Marktwirtschaft im globalen Praxistest: Zwischen Wettbewerb, Wert und Werten
Marktwirtschaft und Wettbewerb haben sich weltweit als Erfolgsmodell etabliert. Über globale Wertschöpfungsketten sind Unternehmen und Konsumenten eng mit der wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Situation in anderen Ländern verbunden. An Unternehmen, Konsumenten und letztlich an die Politik ergeht häufig der Vorwurf, zu wenig für Ökologie, Menschenrechte und soziale Sicherheit bzw. gegen Ausbeutungsverhältnisse und andere Missstände zu tun. Der Band „Globale Verantwortung. Wert und Werte in Marktwirtschaft und Unternehmen“ aus der Denkanstöße-Reihe zeigt eine Vielfalt von Themen und Perspektiven zu globaler Verantwortung von Wirtschaft und Unternehmen und gibt verschiedenen relevanten Akteuren Gelegenheit, ihre Standpunkte darzulegen. Die Herausgeber Dr. Kai Thürbach, Professor für Unternehmensführung und Entrepreneurship an der TH Köln, und Dr. Rainer Völker, wissenschaftlicher Leiter des Instituts für Management und Innovation (IMI) und Professor für Management an der Hochschule für Wirtschaft und Gesellschaft Ludwigshafen am Rhein, standen aus Anlass der Veröffentlichung des Bandes für ein kurzes Interview zur Verfügung.
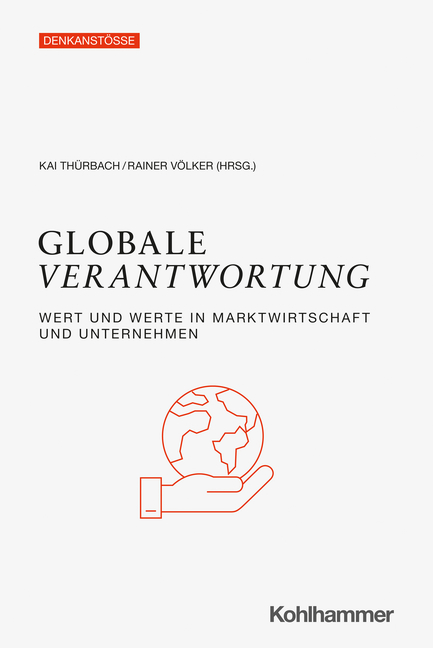
Kai Thürbach/Rainer Völker (Hrsg.)
Globale Verantwortung
Wert und Werte in Marktwirtschaft und Unternehmen
324 Seiten. Kartoniert. € 42,–
ISBN 978-3-17-041118-0
Aus der Reihe Denkanstöße
Nicht wenige Ökonomen vertreten den Standpunkt, dass die Gewinnorientierung bzw. die Profitmaximierung nach wie vor der ideale Weg sei, das unternehmerische Handeln ethisch, nachhaltig, sozial und für die Gesellschaft zielführend zu organisieren – wie stehen Sie dazu?

Vom Grundsatz her hat es sich nicht geändert: Das Streben nach Gewinn bei Unternehmen und das Streben nach Bedürfnisbefriedigung bei Konsumenten sind zentrale Triebfedern. Und die Marktwirtschaft ist die ideale Organisationsform, die die jeweiligen Angebote und die jeweilige Nachfrage effizient koordiniert. Jeder Ökonom weiß allerdings auch, dass eine Laissez-faire-Marktwirtschaft in punkto sozialen Ausgleiches und in Umweltschutzfragen versagen muss. Insofern gibt der Staat soziale Regelungen vor und muss auch bei ökologischen Themen intervenieren. Hier gibt es allerdings zwei Grundvarianten: In der Nachhaltigkeitsdebatte – egal, ob beispielsweise bei Vermeidung von Müll oder in der Energiepolitik – kann man durch Verbote agieren oder wieder über Preise Marktmechanismen wirken lassen. Meistens sind Marktmechanismen in der Effizienz überlegen. Es braucht also beides: wettbewerblich verfasste Märkte und eben passende Eingriffe des Staates. Die Frage nach der dazu passenden Balance ist übrigens ein wichtiger Aspekt in unserem Buch.
Bildet die inzwischen recht umfangreiche Schutzgesetzgebung für Ökologie, Menschenrechte, soziale Sicherheit u. a. nicht einen Standortnachteil für deutsche Unternehmen?

Oberflächlich – nur auf momentane Kosten bezogen – könnte man dies so sehen. Aber zum einen müssen wir alle – auch Unternehmensverantwortliche – uns den globalen Problemen stellen und entsprechend Verantwortung übernehmen. Die Einhaltung von Menschenrechten entlang der ausgelösten Wertkette sollte ohnehin selbstverständlich sein. Klar, die Frage ist schon, wenn wir an manche Gesetzgebung in der Klimafrage denken, was die richtige Dosierung bei Regeln ist? Macht es Sinn hier mit heimischen Verboten voranzugehen und dann etwa zu merken – wie dies jetzt Studien zeigen – dass die eingesparten Brennstoffe schlicht in anderen Ländern nachgefragt und verbraucht werden? Manche Gesetze sind gut gemeint, entfalten aber nicht die gewünschte Wirkung, leisten also am Ende keinen Beitrag dazu, die Welt besser zu machen. Auch das sieht man leider. Komplexe Sachverhalte lassen sich eben manchmal nicht einfach lösen, auch wenn wir uns das wünschen.
Die deutsche Wirtschaft erlebt zurzeit eine Rezession und viele warnen vor einer Überforderung, insbesondere das „Lieferkettengesetz“ mit seinen differenzierten Haftungsregeln stand im Zentrum der Kritik. Wie beurteilen Sie die aktuelle Lage?
Zum Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz ist anzumerken, dass deutsche Unternehmen darauf schon recht gut vorbereitet waren. Auch die Notwendigkeit hier initiativ zu werden, wird bei vielen Unternehmen gesehen. Aber wie vorhin schon angemerkt: Bei solchen Regelungen kommt es zentral auf die Ausgestaltung an. Es gilt, frühzeitig mit Wirtschaftsverbänden zu sprechen, zu erkennen wie man Gesetze praktikabel ausgestalten kann und wie möglichst unnötige Bürokratie vermieden wird. Wie einige Beispiele zeigen, werden solche an und für sich einfachen Grundsätze nicht immer beachtet.
Sie zeigen in dem von Ihnen herausgegebenen Band auch Beispiele aus der modernen Managementausbildung, die auf soziale, ökologische und gesellschaftlich-ethische Aspekte ausgerichtet sind. Ist das gemessen an der wirtschaftlichen Praxis mit ihrem harten Kostenwettbewerb nicht Augenwischerei aus dem Elfenbeinturm?
Sicherlich gibt es bei der Außendarstellung von Unternehmen noch zu viel Greenwashing. Nach unseren Erfahrungen gilt es aber zwei Dinge festzuhalten: Zum einen gibt es eine stetig steigende und vor allem ehrliche Nachfrage von Unternehmensseite nach einer Aus- und Weiterbildung im Bereich Nachhaltigkeitsmanagement. Circular Design Economy oder nachhaltiges Innovationsmanagement sind entsprechende Schlagworte. Aufgrund eines wachsenden Drucks seitens der Gesellschaft und letztlich auch von den Aktienmärkten, kann sich eine moderne Unternehmensführung dem nicht verschließen. Zum anderen gibt es immer mehr Geschäftsführer und Eigentümer, die sich in einer globalen Verantwortung und/oder in einer Verantwortung gegenüber nachfolgenden Generationen sehen. Manche Eigentümer wollen ihr Unternehmen als klimaneutrales und „global gerechtes“ Unternehmen an ihre Nachfolger übergeben. Viele Manager und Unternehmer nehmen ihre Verantwortung ernst – am Ende sind sie es, die diese Themen im täglichen Wirtschaften nach vorne bringen. Aber es kommt eben auch auf gute und klug konzipierte Rahmenbedingungen, den Kontext, an. Dieses Spannungsverhältnis beleuchtet das Buch auch.
Zum Schluss ein Blick in die Zukunft: Wo sehen Sie die Soziale Marktwirtschaft, die in diesem Jahr ihren 75. Geburtstag feiert und zum weltweiten Markenzeichen geworden ist, in 25 Jahren?
Wir denken, dass die soziale Marktwirtschaft nach wie vor ein Erfolgsmodell bleiben wird. Jedoch sind sinnvolle ökologische Regeln, die zum Prinzip einer Marktwirtschaft passen, zum Beispiel ein CO2-Preis, noch stärker zu integrieren. Dass dies geht und wichtig ist, wussten schon Ökonomen aus der Mitte des letzten Jahrhunderts. In einer globalen Welt, die auch in unserem Buch skizziert wird, genügt es allerdings nicht, wenn nur einzelne Staaten vorangehen. Im Gegensatz zu früher ist die Welt von heute viel stärker durch die Freizügigkeit von Kapital, Menschen und Waren, durch Lieferketten oder durch die Klimaproblematik miteinander verbunden. Sicher ist es zunächst positiv zu sehen, wenn Staaten im Hinblick auf Absicherung, Umwelt- und Klimaschutz vorangehen. Ähnlich wie einzelne Unternehmen stehen Staaten in einem Wettbewerb und ein zu starkes, einseitiges Vorangehen kann zum Verlust der guten Wettbewerbsposition oder gar zum Niedergang führen. Damit ist weder dem eigenen Land noch der Welt gedient, denn das löst die globalen Probleme nicht, sondern verlagert sie nur woanders hin. Nicht zuletzt die Klimaproblematik zeigt, dass ein kluges, abgestimmtes Handeln notwendig wäre.
Haben Sie vielen Dank für das Gespräch!