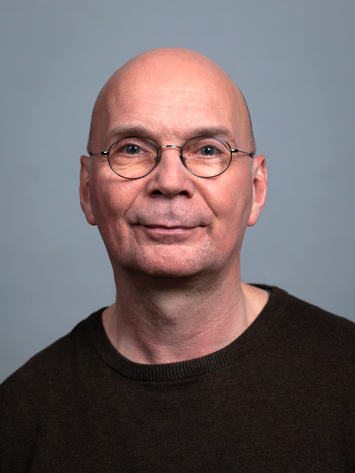 Der Altenpfleger Sebastian Kraus erscheint als ein Mann der Tat. Den „begegnungsorientierten Ansatz bei Menschen mit Demenz“ bringt er in die Diskussion um die Versorgung pflegebedürftiger Menschen ein. In der Begegnung sieht der erfahrene Praktiker eine konkrete Möglichkeit positiver zwischenmenschlicher Interaktionen. Sebastian Kraus hat Christoph Müller bei einer Tasse Tee erzählt, was seine Ideen ausmachen.
Der Altenpfleger Sebastian Kraus erscheint als ein Mann der Tat. Den „begegnungsorientierten Ansatz bei Menschen mit Demenz“ bringt er in die Diskussion um die Versorgung pflegebedürftiger Menschen ein. In der Begegnung sieht der erfahrene Praktiker eine konkrete Möglichkeit positiver zwischenmenschlicher Interaktionen. Sebastian Kraus hat Christoph Müller bei einer Tasse Tee erzählt, was seine Ideen ausmachen.
Christoph Müller Lieber Sebastian Kraus, was macht denn eigentlich den „begegnungsorientierten Ansatz bei Menschen mit Demenz“ aus?
Sebastian Kraus Der begegnungsorientierte Ansatz wurde aus der konkreten Praxis von Pflegenden und Betreuenden heraus entwickelt. Im Zentrum des begegnungsorientierten Modells steht dabei einerseits eine ganzheitliche Sichtweise, in der nicht allein psychische, sondern ebenso physische Grundbedürfnisse wahrgenommen werden, die ja ebenso Einfluss auf das Wohlbefinden von Menschen mit Demenz und ihr interaktives Verhalten haben. Zugleich geht es aus pflegerischer Perspektive darum, einen neuen und bedürfnisorientierten Ansatz in der Alltagsbegleitung und Pflege von Menschen mit Demenz zu verfolgen und sich in diesem Zug von den früheren defizitorientierten Handlungs- und Wahrnehmungsmustern zu lösen.
Christoph Müller Wie sind Sie auf die Idee gekommen, den „begegnungsorientierten Ansatz bei Menschen mit Demenz“ zu entwickeln?
Sebastian Kraus Ausgangspunkt des begegnungsorientierten Ansatzes war zunächst der Versuch, in der Interaktion und Begegnung mit Menschen mit Demenz neue Wege im Umgang mit situativen Verkennungen und mit sogenannten “herausfordernden” Verhaltensweisen von Menschen mit Demenz zu erproben. Primäres Ziel dabei war, eskalierenden Situationsentwicklungen gegenüber vorzubeugen, und den Einsatz von Psychopharmaka zur Verhaltensmodifikation zu reduzieren oder aber womöglich auch ganz zu vermeiden. Dies bedeutete in der Praxis, Möglichkeiten der Interaktion und Begegnung auch dort zu auszuloten, wo eine sprachliche Verständigung nur noch eingeschränkt oder gar nicht mehr möglich ist.
Christoph Müller Schon in den einleitenden Worten schreiben Sie: „Nicht nur Menschen mit Demenz leben in ihrer eigenen Realität und Wahrnehmungswelt, auch wir tun es selbst.“ Wie meinen Sie dies?
Sebastian Kraus Wie wir Realität wahrnehmen, erleben und für uns selber interpretieren ist immer auch abhängig von unseren Ansichten und Überzeugungen, unseren eigenen Wahrnehmungs- und Deutungsmustern. Was wir selber als wirklich erfahren oder Wirklichkeit nennen, oder was für uns wahr und real ist, ist somit immer auch ein Ergebnis unserer individuellen Wirklichkeitskonzeption. Dies trifft gleichermaßen auf uns selbst zu, wie auf Menschen mit Demenz, auch wenn sich situative Wahrnehmung und situatives Verhalten im Entwicklungsverlauf der Demenz verändern und für uns manchmal schwer begreifbar erscheinen.
Christoph Müller Sie nutzen den Begriff der Pflegekultur. Dies ist selten. Was meinen Sie mit diesem Terminus? Was meinen Sie mit der Veränderbarkeit der Pflegekultur?
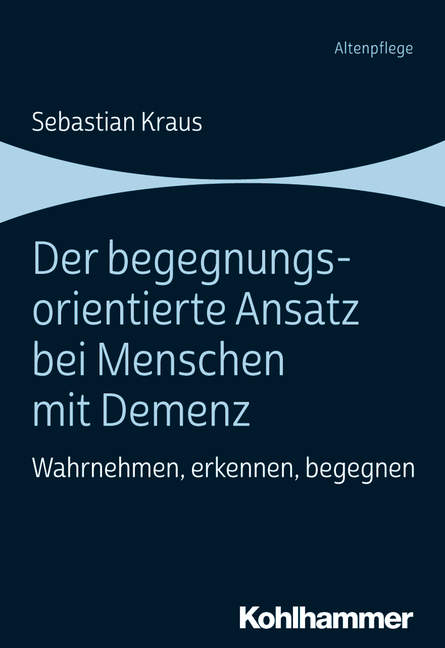 Sebastian Kraus Vielleicht können wir, stark vereinfach gesagt, als Pflegekultur den Bereich bezeichnen, in dem eine bestimmte Kultur und Gesellschaft darüber übereinkommt, welchen Umgang mit pflegebedürftigen Menschen sie für angemessen hält. Eine Pflegekultur definiert dabei einerseits, welche pflegerischen Handlungs- und Umgangsweisen innerhalb eines kulturellen und sozialen Kontexts als notwendig und richtig gelten und als gängige oder normale Praxis betrachtet werden. Zugleich weist sie Pflegebedürftigen und Pflegenden in der Interaktion bestimmte Rollen und Handlungsräume zu. Dies gilt auch für die Interaktionen von Pflegenden und Betreuenden in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Pflegekultur und Gesellschaft bewegen sich dabei stets in einem engen Wechselverhältnis zueinander und in einem dynamischen Prozess der Veränderung. Die Veränderung einer Pflegekultur bedeutet somit immer auch die Veränderung der Gesellschaft.
Sebastian Kraus Vielleicht können wir, stark vereinfach gesagt, als Pflegekultur den Bereich bezeichnen, in dem eine bestimmte Kultur und Gesellschaft darüber übereinkommt, welchen Umgang mit pflegebedürftigen Menschen sie für angemessen hält. Eine Pflegekultur definiert dabei einerseits, welche pflegerischen Handlungs- und Umgangsweisen innerhalb eines kulturellen und sozialen Kontexts als notwendig und richtig gelten und als gängige oder normale Praxis betrachtet werden. Zugleich weist sie Pflegebedürftigen und Pflegenden in der Interaktion bestimmte Rollen und Handlungsräume zu. Dies gilt auch für die Interaktionen von Pflegenden und Betreuenden in der Arbeit mit Menschen mit Demenz. Pflegekultur und Gesellschaft bewegen sich dabei stets in einem engen Wechselverhältnis zueinander und in einem dynamischen Prozess der Veränderung. Die Veränderung einer Pflegekultur bedeutet somit immer auch die Veränderung der Gesellschaft.
Christoph Müller Ihre Beschreibungen sind konkret. Sie berichten viele Erlebnisse und Erfahrungen aus der pflegerischen Praxis. Da bleibt es nicht aus, dass Sie von Authentizität und Glaubwürdigkeit der Pflegenden schreiben. Welche Ahnung haben Sie davon, was dies den dementiell veränderten Menschen bedeutet?
Sebastian Kraus Vorhin hatten wir bereits über die Frage unserer Wirklichkeitskonzeption und Wahrnehmung gesprochen. Menschen mit Demenz, die nicht mehr mit den früheren kognitiven Mitteln feststellen können, inwieweit etwas wirklich ist, oder wahr, werden sich in der Interaktion und Begegnung mit uns vielleicht an anderen Kriterien orientieren, z.B. an einer Übereinstimmung zwischen unserer Mimik und Gestik und der Art und Weise, in der wir dabei sprechen. Sie werden möglicherweise intuitiver und gefühlsmäßiger entscheiden, ob eine Aussage von uns stimmig und wahr ist, positiv, gut gemeint oder aber auch nicht. Unsere Glaubwürdigkeit und Echtheit in den eigenen Mitteilungen und Begegnungsangeboten ist auf diese Weise ein ganz wesentlicher Faktor in der wechselseitigen Interaktion und der möglichen Orientierung darin. Es geht nicht nur darum unser Gegenüber in der Interaktion und Begegnung wahrzunehmen, sondern ebenso darum, für den Anderen dabei lesbar zu sein.
Christoph Müller Wenn Sie über Nähe und Distanz schreiben, wird man selbst fast demütig. Sie schreiben darüber, dass das Gebrauchen des Pronomens „Du“ im situativen Kontext den Mitmenschen stärken sollte. Wie können Pflegende diese Reflexionsfähigkeit und Reflexionsbereitschaft erreichen?
Sebastian Kraus Neue Ansätze für die Interaktion und Arbeit mit Menschen mit Demenz müssen sich letztlich an der Wirksamkeit messen lassen, die sie zu entfalten vermögen. Ansonsten sind es nur Papierschiffchen, die wir bauen. Ich habe selbst innerhalb meiner eigenen Praxis erlebt, dass wir Pflegende dann am besten erreichen, wenn Veränderungen ihrer gewohnten Handlungsweisen ihre Arbeit letztendlich erleichtern und etwas anschließend besser funktioniert als zuvor. Dies gilt auch für den Bereich der Selbstreflexion und des fachlichen Austauschs mit anderen. Ein bewusster und reflektierter Umgang mit den eigenen Begegnungsangeboten in der Interaktion mit Menschen mit Demenz kann nicht nur dazu führen, die Wahrscheinlichkeit situativer Verkennungen oder eskalierender Situationsentwicklungen zu verringern. Er wird uns dabei auch neue Handlungsspielräume und Mitteilungsebenen eröffnen. Ich habe versucht, dies im Buch anhand unterschiedlicher Fallbeispiele aus der Praxis zu veranschaulichen.
Christoph Müller Im biographischen Arbeiten geht es für Sie darum, „an vertraute Erfahrungen, Kompetenzen und Fähigkeiten anknüpfen zu können, die die Kontinuität in der eigenen Geschichte und die darin erfahrbare Identität auch außerhalb des Erzählbaren und Bewussten erlebbar machen“ (S. 107). Seien Sie doch so freundlich und machen dies nachvollziehbar?
Sebastian Kraus Im begegnungsorientierten Modell bedeutet biographisches Arbeiten Alltagsnormalität, Identität und Person-Sein in der Alltagsbegleitung von Menschen mit Demenz erfahrbar zu machen. Auf der basalen Ebene kann dies z.B. auch die Arbeit mit der körperlichen Biografie des Anderen bedeuten, die Erinnerung an den eigenen Körper durch Berührung oder aber den Umgang mit bestimmten Materialien. Es geht weniger darum, eine frühere Lebensgeschichte innerhalb der Erinnerung wiederherzustellen, sondern vielmehr darum in der Gegenwart Anknüpfungspunkte für die Interaktion mit anderen zu finden, für die Selbstwahrnehmung und Begegnung mit sich selbst.
Christoph Müller Ich wünsche Ihnen, dass Ihr „begegnungsorientierter Ansatz bei Menschen mit Demenz“ eine weite Verbreitung finden wird.
Das Interview führte Christoph Müller in der Reihe „CHRISTOPHS PFLEGE-CAFÉ“, https://pflege-professionell.at/
Herrn MĂĽller und Herrn Kraus danken wir sehr dafĂĽr, dass Sie uns dieses interessante Interview zur VerfĂĽgung stellen.
Nähere Informationen zum betreffendem Buch erhalten Sie, wenn Sie auf den folgenden Titel klicken:

