 Dr. Christoph Raichle ist seit 2013 wissen┬¡schaft┬¡licher Mit┬¡ar┬¡bei┬¡ter an der Uni┬¡ver┬¡si┬¡t├ñt Stutt┬¡gart am Lehr┬¡stuhl f├╝r Neuere Ge┬¡schichte so┬¡wie Mit┬¡ar┬¡bei┬¡ter der For┬¡schungs┬¡stelle Lud┬¡wigs┬¡burg. Der Na┬¡tio┬¡nal┬¡sozia┬¡lis┬¡mus geh├Ârt zu seinen For┬¡schungs┬¡schwer┬¡punkten: So widmete er sich in seiner Doktor┬¡arbeit ÔÇ×Hitler als Symbol┬¡poli┬¡tikerÔÇ£ und setzt sich nun in seiner neuen Mono┬¡graphie zur ÔÇ×Finanz┬¡verwaltung in Baden und W├╝rt┬¡tem┬¡berg im National┬¡sozia┬¡lis┬¡musÔÇ£ mit den T├ñtig┬¡keiten und Hand┬¡lungs┬¡spiel┬¡r├ñumen dieser Beh├Ârde sowie ihrem Ansehen nach 1945 aus┬¡ein┬¡ander. Mit diesem Werk bietet er erst┬¡malig eine detail┬¡lierte Aus┬¡wer┬¡tung der fis┬¡kali┬¡schen Quellen dieser Zeit.
Dr. Christoph Raichle ist seit 2013 wissen┬¡schaft┬¡licher Mit┬¡ar┬¡bei┬¡ter an der Uni┬¡ver┬¡si┬¡t├ñt Stutt┬¡gart am Lehr┬¡stuhl f├╝r Neuere Ge┬¡schichte so┬¡wie Mit┬¡ar┬¡bei┬¡ter der For┬¡schungs┬¡stelle Lud┬¡wigs┬¡burg. Der Na┬¡tio┬¡nal┬¡sozia┬¡lis┬¡mus geh├Ârt zu seinen For┬¡schungs┬¡schwer┬¡punkten: So widmete er sich in seiner Doktor┬¡arbeit ÔÇ×Hitler als Symbol┬¡poli┬¡tikerÔÇ£ und setzt sich nun in seiner neuen Mono┬¡graphie zur ÔÇ×Finanz┬¡verwaltung in Baden und W├╝rt┬¡tem┬¡berg im National┬¡sozia┬¡lis┬¡musÔÇ£ mit den T├ñtig┬¡keiten und Hand┬¡lungs┬¡spiel┬¡r├ñumen dieser Beh├Ârde sowie ihrem Ansehen nach 1945 aus┬¡ein┬¡ander. Mit diesem Werk bietet er erst┬¡malig eine detail┬¡lierte Aus┬¡wer┬¡tung der fis┬¡kali┬¡schen Quellen dieser Zeit.
Was hat Sie zur Unter­su­chung der Finanz­ver­wal­tung in Baden und Würt­tem­berg im Natio­nal­sozia­lis­mus bewegt?
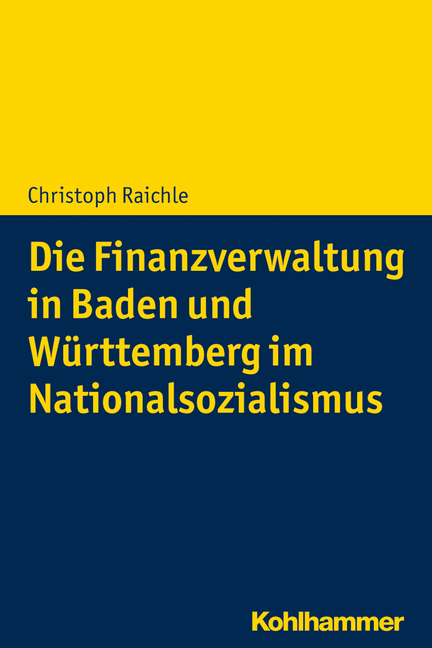 Ich inte┬¡res┬¡sie┬¡re mich schon l├ñnger f├╝r poli┬¡tische Kultur┬¡geschichte, also f├╝r die Frage, wie von vielen Menschen geteil┬¡te Sinn┬¡muster ent┬¡stehen und wie sie sich im poli┬¡ti┬¡schen Raum aus┬¡wirken. Als mein Doktor┬¡vater, Prof. Dr. Wolfram Pyta (Uni┬¡ver┬¡si┬¡t├ñt Stutt┬¡gart), mit dem An┬¡ge┬¡bot an mich he┬¡ran┬¡trat, eine Stu┬¡die ├╝ber die Fi┬¡nanz┬¡ver┬¡wal┬¡tung in Baden und W├╝rt┬¡tem┬¡berg im ÔÇ×Drit┬¡ten ReichÔÇ£ zu ver┬¡fassen und dabei auch den Aspekt der Ver┬¡wal┬¡tungs┬¡kul┬¡tur zu be┬¡r├╝ck┬¡sich┬¡ti┬¡gen, hat mich das so┬¡fort ge┬¡packt. Es soll┬¡te eine Studie ├╝ber Ver┬¡wal┬¡tungs┬¡ge┬¡schich┬¡te ent┬¡ste┬¡hen, die nicht trocken die Rechts- und Ins┬¡ti┬¡tu┬¡tio┬¡nen┬¡geschichte refe┬¡riert, son┬¡dern die sozu┬¡sagen mit Leben gef├╝llt wird: mit dem kon┬¡kre┬¡ten Ver┬¡wal┬¡tungs┬¡han┬¡deln der Be┬¡am┬¡ten vor Ort. Na┬¡t├╝r┬¡lich gab es eine Viel┬¡zahl wei┬¡te┬¡rer A┬¡spek┬¡te, die zu be┬¡r├╝ck┬¡sich┬¡ti┬¡gen waren, ins┬¡be┬¡son┬¡dere hat mich dabei auch das Schick┬¡sal der Op┬¡fer inte┬¡res┬¡siert, die vor der phy┬¡si┬¡schen Ver┬¡fol┬¡gung einer mas┬¡si┬¡ven fi┬¡nan┬¡ziel┬¡len Ver┬¡fol┬¡gung aus┬¡ge┬¡setzt wa┬¡ren.
Ich inte┬¡res┬¡sie┬¡re mich schon l├ñnger f├╝r poli┬¡tische Kultur┬¡geschichte, also f├╝r die Frage, wie von vielen Menschen geteil┬¡te Sinn┬¡muster ent┬¡stehen und wie sie sich im poli┬¡ti┬¡schen Raum aus┬¡wirken. Als mein Doktor┬¡vater, Prof. Dr. Wolfram Pyta (Uni┬¡ver┬¡si┬¡t├ñt Stutt┬¡gart), mit dem An┬¡ge┬¡bot an mich he┬¡ran┬¡trat, eine Stu┬¡die ├╝ber die Fi┬¡nanz┬¡ver┬¡wal┬¡tung in Baden und W├╝rt┬¡tem┬¡berg im ÔÇ×Drit┬¡ten ReichÔÇ£ zu ver┬¡fassen und dabei auch den Aspekt der Ver┬¡wal┬¡tungs┬¡kul┬¡tur zu be┬¡r├╝ck┬¡sich┬¡ti┬¡gen, hat mich das so┬¡fort ge┬¡packt. Es soll┬¡te eine Studie ├╝ber Ver┬¡wal┬¡tungs┬¡ge┬¡schich┬¡te ent┬¡ste┬¡hen, die nicht trocken die Rechts- und Ins┬¡ti┬¡tu┬¡tio┬¡nen┬¡geschichte refe┬¡riert, son┬¡dern die sozu┬¡sagen mit Leben gef├╝llt wird: mit dem kon┬¡kre┬¡ten Ver┬¡wal┬¡tungs┬¡han┬¡deln der Be┬¡am┬¡ten vor Ort. Na┬¡t├╝r┬¡lich gab es eine Viel┬¡zahl wei┬¡te┬¡rer A┬¡spek┬¡te, die zu be┬¡r├╝ck┬¡sich┬¡ti┬¡gen waren, ins┬¡be┬¡son┬¡dere hat mich dabei auch das Schick┬¡sal der Op┬¡fer inte┬¡res┬¡siert, die vor der phy┬¡si┬¡schen Ver┬¡fol┬¡gung einer mas┬¡si┬¡ven fi┬¡nan┬¡ziel┬¡len Ver┬¡fol┬¡gung aus┬¡ge┬¡setzt wa┬¡ren.
Ihre Arbeit ist aus­ge­spro­chen um­fang­reich, detail­liert und akri­bisch re­cher­chiert. Auf wel­che Vor­ar­bei­ten und Quellen konn­te sich Ihre Ar­beit stützen?
Die Vor┬¡arbei┬¡ten f├╝r Baden und W├╝rt┬¡tem┬¡berg sind, wenn es kon┬¡kret um die Fi┬¡nanz┬¡be┬¡h├Âr┬¡den geht, denk┬¡bar ge┬¡ring. Es gab nur ei┬¡nige knappe Pub┬¡li┬¡ka┬¡tio┬¡nen von ehe┬¡mali┬¡gen Be┬¡am┬¡ten der Fi┬¡nanz┬¡ver┬¡wal┬¡tung, die kaum auf das ÔÇ×Dritte ReichÔÇ£ ein┬¡gin┬¡gen, schon gar nicht auf Ein┬¡zel┬¡fra┬¡gen der fi┬¡nan┬¡ziel┬¡len Aus┬¡pl├╝n┬¡derung der Juden. Statt┬¡dessen zeich┬¡neten sie das Bild einer ÔÇ×sau┬¡be┬¡renÔÇ£ Ver┬¡wal┬¡tung. Das hing auch damit zusam┬¡men, dass man weit┬¡hin der An┬¡sicht war, die Be┬¡am┬¡ten vor Ort in den Fi┬¡nanz┬¡├ñmter h├ñt┬¡ten ohne┬¡hin nur die Ver┬¡ord┬¡nun┬¡gen aus Ber┬¡lin Buch┬¡stabe f├╝r Buch┬¡stabe voll┬¡zogen, ohne ei┬¡gene Hand┬¡lungs┬¡spiel┬¡r├ñume. Dabei muss┬¡ten ge┬¡rade die ÔÇ×Ehe┬¡mali┬¡genÔÇ£ es bes┬¡ser wis┬¡sen.
Auch die Quel┬¡len┬¡lage ist sehr schwie┬¡rig, ein gro├ƒer Teil der rele┬¡van┬¡ten Ak┬¡ten wur┬¡de 1944/45 zer┬¡st├Ârt. Und bis 1999 waren wegen des Steuer┬¡geheim┬¡nis┬¡ses nicht ein┬¡mal diese weni┬¡gen noch erhal┬¡te┬¡nen Ak┬¡ten zu┬¡g├ñng┬¡lich. Erst in den letz┬¡ten 15 Jahren wur┬¡den in an┬¡de┬¡ren Bun┬¡des┬¡l├ñn┬¡dern wis┬¡sen┬¡schaft┬¡liche Stu┬¡dien zum Thema Fi┬¡nanz┬¡ver┬¡wal┬¡tung auf mitt┬¡le┬¡rer und un┬¡te┬¡rer Ebene vor┬¡ge┬¡legt. Diese Stu┬¡dien waren als Orien┬¡tie┬¡rung sehr hilf┬¡reich. Un┬¡ver┬¡zicht┬¡bar waren aber auch viele Lokal┬¡stu┬¡dien, die eher neben┬¡bei Details ├╝ber die fi┬¡nan┬¡zielle Ver┬¡fol┬¡gung von Juden berichten.
In welcher Hin­sicht be­deu­tete der Be­ginn des Natio­nal­sozia­lis­mus über­haupt einen Ein­schnitt für die Fin­anz­ver­waltung?
Ent­las­sen wurden 1933 nur sehr wenige Finanz­beamte. Man war auch im Na­tio­nal­sozia­lis­mus auf diese Fach­leute an­ge­wiesen. Die NSDAP setzte da­her auf An­pas­sung der Be­am­ten und die Nazi­fi­zie­rung der Per­so­nal­poli­tik. Die Be­am­ten standen von nun an unter dauern­der poli­ti­scher Be­obach­tung und ins­titu­tio­nel­lem Druck zur Mit­ar­beit. Die Dik­ta­tur ging auch an der Fi­nanz­ver­wal­tung nicht vorbei.
Auf steu┬¡er┬¡lichem Gebiet war der Ein┬¡schnitt 1933 nicht so gro├ƒ, die Steuer┬¡ge┬¡setze blie┬¡ben auf dem Papier zu┬¡n├ñchst un┬¡ver┬¡├ñn┬¡dert. Aller┬¡dings bot die Dik┬¡ta┬¡tur auch hier neue Spiel┬¡r├ñume f├╝r Par┬¡tei┬¡akti┬¡visten, f├╝r Anti┬¡semi┬¡ten oder schlicht f├╝r oppor┬¡tunis┬¡tische Karrie┬¡ris┬¡ten. Ebenso sind Steuer┬¡ge┬¡setze, wenn es kon┬¡kret wird, eine Sache der Aus┬¡le┬¡gung und Aus┬¡hand┬¡lung. Juden und poli┬¡tisch Ver┬¡folg┬¡te waren oft ein┬¡ge┬¡sch├╝ch┬¡tert und trau┬¡ten sich nicht mehr, Ein┬¡spruch ein┬¡zu┬¡legen oder den Rechts┬¡weg zu be┬¡schrei┬¡ten. Mit den Jahren wurden die Steuer- und Devisen┬¡gesetze dann so ver┬¡├ñn┬¡dert, dass gerade j├╝┬¡di┬¡sche Aus┬¡wan┬¡derer getroffen wurden. Diese kamen meist v├Âllig ver┬¡armt im Aus┬¡land an. Ab 1938 wur┬¡den dann ganz offen Juden ├╝ber Steuern und Ab┬¡gaben aus┬¡ge┬¡pl├╝n┬¡dert, beginnend mit der zy┬¡ni┬¡schen ÔÇ×Juden┬¡ver┬¡m├Âgens┬¡abgabeÔÇ£ nach dem No┬¡vem┬¡ber┬¡pogrom 1938. Wie auf ande┬¡ren Gebie┬¡ten haben wir also ├╝ber die Jahre eine schritt┬¡weise Radi┬¡kali┬¡sie┬¡rung der Ver┬¡fol┬¡gungs┬¡ma├ƒ┬¡nah┬¡men, die ersten Risse im Damm stam┬¡men aber aus dem Jahr 1933.
Welche Hand­lungs­spiel­räume besaß die Fi­nanz­ver­wal­tung zur Zeit des Na­tio­nal­sozia­lis­mus?
Zen┬¡trale Vorgaben kamen nat├╝r┬¡lich aus Berlin. Hier wurde der Pro┬¡zess der Radi┬¡kali┬¡sie┬¡rung ge┬¡steu┬¡ert. Die Kom┬¡pe┬¡ten┬¡zen des Rei┬¡ches wuch┬¡sen nach 1933 durch ÔÇ×Gleich┬¡schal┬¡tungÔÇ£ und ÔÇ×Ver┬¡reich┬¡li┬¡chungÔÇ£. Das hei├ƒt aber nicht, dass es auf mitt┬¡lerer und un┬¡te┬¡rer Ebene keine Spiel┬¡r├ñume mehr gab. In Mann┬¡heim etwa ent┬¡wickel┬¡te das Fi┬¡nanz┬¡amt das sog. ÔÇ×Mann┬¡heimer Sys┬¡temÔÇ£, das ge┬¡zielt wohl┬¡ha┬¡bende Juden bei der Reichs┬¡flucht┬¡steuer aufs Korn nahm. Diese Steuer muss┬¡ten alle Aus┬¡wan┬¡derer mit einem gewis┬¡sen Ver┬¡m├Â┬¡gen be┬¡zah┬¡len, aber die Juden wur┬¡den zur Aus┬¡wan┬¡derung ge┬¡dr├ñngt, ja ab 1938 prak┬¡tisch ge┬¡zwun┬¡gen. Es war den Be┬¡am┬¡ten also klar, wer durch die vor Ort erson┬¡nenen Ver┬¡sch├ñr┬¡fun┬¡gen ge┬¡trof┬¡fen wurde, und das wurde intern auch ganz offen bekannt und be┬¡jaht. Viele Be┬¡am┬¡ten sahen es als ihre h├Âchste Auf┬¡gabe an, dem Reich Geld f├╝r die zahl┬¡rei┬¡chen Auf┬¡gaben zu ver┬¡schaffen: f├╝r Ar┬¡beits┬¡beschaf┬¡fung, Auf┬¡r├╝s┬¡tung, ab 1939 f├╝r den Krieg. Dabei waren l├ñngst nicht alle diese Be┬¡am┬¡ten Par┬¡tei┬¡akti┬¡vis┬¡ten. Wie weit geh├ñssige Anti┬¡semi┬¡ten gehen konn┬¡ten, zeigt der Fall des Lei┬¡ters der Stutt┬¡garter De┬¡visen┬¡stelle Ernst Nie┬¡mann. Er hat sein Amt prak┬¡tisch mit ÔÇ×Mein KampfÔÇ£ unterm Arm gelei┬¡tet und schreck┬¡te vor einer Viel┬¡zahl von Rechts┬¡br├╝chen nicht zu┬¡r├╝ck; durch will┬¡k├╝r┬¡liche Ver┬¡haf┬¡tun┬¡gen, Er┬¡pressun┬¡gen und sys┬¡tema┬¡tische Sippenhaft woll┬¡te er Devi┬¡sen f├╝r die Auf┬¡r├╝s┬¡tung er┬¡lan┬¡gen. Rein┬¡hold Maier, der erste Minis┬¡ter┬¡pr├ñ┬¡sident von Baden-W├╝rttemberg, nannte Niemann sp├ñter das ÔÇ×Schreck┬¡ge┬¡spenst der ganzen j├╝di┬¡schen Be┬¡v├Âl┬¡kerung von W├╝rt┬¡tem┬¡bergÔÇ£.
Ein wesent┬¡li┬¡ches Er┬¡geb┬¡nis Ihrer Arbeit ist, dass die Fi┬¡nanz┬¡ver┬¡wal┬¡tung keines┬¡wegs ein ÔÇ×sauberesÔÇ£ Amt war, sondern sich an der Ent┬¡zie┬¡hung, Ver┬¡wal┬¡tung und Ver┬¡wer┬¡tung j├╝di┬¡scher Ver┬¡m├Âgen aktiv be┬¡tei┬¡ligte. Wie konnte das Selbst┬¡bild der Un┬¡be┬¡stech┬¡lich┬¡keit und Sau┬¡ber┬¡keit nach 1945 ├╝ber┬¡haupt ent┬¡ste┬¡hen und lange Zeit auf┬¡recht ge┬¡hal┬¡ten werden?
Die an der Ver┬¡m├Âgens┬¡ver┬¡wer┬¡tung be┬¡tei┬¡lig┬¡ten Be┬¡am┬¡ten beriefen sich (wie so vie┬¡le an┬¡dere nach 1945) da┬¡rauf, le┬¡dig┬¡lich Anord┬¡nun┬¡gen h├Âhe┬¡rer Stellen aus┬¡ge┬¡f├╝hrt zu haben. Die Be┬¡amten sahen sich als Befehls┬¡emp┬¡f├ñn┬¡ger, die auf den Staat ver┬¡pflich┬¡tet wa┬¡ren und ├ñhn┬¡lich wie Sol┬¡da┬¡ten ei┬¡nen Amts┬¡eid geleistet hatten. Ein Stutt┬¡garter Gericht befand au├ƒer┬¡dem im Jahr 1949, dass ja die Gestapo das Unrecht der De┬¡por┬¡ta┬¡tio┬¡nen zu verant┬¡worten h├ñtte. Man schob die Schuld also auf ÔÇ×die NazisÔÇ£: auf die Partei und die von der SS durch┬¡setzte Poli┬¡zei. Diese Schuld┬¡zu┬¡wei┬¡sung an ver┬¡gleichs┬¡weise we┬¡nige er┬¡laub┬¡te die Rein┬¡waschung vie┬¡ler ande┬¡rer. Das lag im Trend der Zeit nach 1945, ebenso das Be┬¡schwei┬¡gen und Be┬¡sch├Â┬¡nigen. Den Fi┬¡nanz┬¡├ñm┬¡tern kam dabei ihr tradi┬¡tio┬¡nel┬¡les An┬¡sehen der an┬¡geb┬¡lichen Unbe┬¡stech┬¡lich┬¡keit des deut┬¡schen Be┬¡amten zugute, viel┬¡leicht auch der Um┬¡stand, dass man mit Finanz┬¡├ñmtern all┬¡gemein eher einen oft um┬¡st├ñnd┬¡lichen, aber doch im Grunde eher harm┬¡losen For┬¡mular┬¡krieg assozi┬¡iert. Auch die Opfer benann┬¡ten in ihren ├äu┬¡├ƒerun┬¡gen nach 1945 oft Ge┬¡sta┬¡po┬¡beamte, SA- und SS-M├ñnner als T├ñter, die ihnen be┬¡sonders in Erin┬¡nerung geblie┬¡ben waren, sehr selten aber Fi┬¡nanz┬¡beam┬¡te. Das hing auch damit zu┬¡sam┬¡men, dass Gewalt┬¡erfah┬¡rungen oder der schwie┬¡rige Neu┬¡anfang der Aus┬¡wande┬¡rer im Aus┬¡land in der Regel die Erin┬¡nerung an die zuvor er┬¡fah┬¡rene fi┬¡nan┬¡zielle Aus┬¡pl├╝n┬¡derung ├╝ber┬¡lager┬¡ten. Die Mehr┬¡zahl der Finanz┬¡beam┬¡ten hielt sich an die k├╝hle, sach┬¡liche Fach┬¡sprache ihres Berufs┬¡standes, sodass sie als Han┬¡deln┬¡de gleich┬¡sam hinter den Buch┬¡staben des Geset┬¡zes zu┬¡r├╝ck┬¡traten. Man setzte zwar Un┬¡recht um, wahrte dabei aber die Fas┬¡sade des b├╝r┬¡ger┬¡lichen Rechts┬¡staates. Dies war viel┬¡leicht ├╝ber┬¡haupt der wich┬¡tigste Beitrag der Fi┬¡nanz┬¡ver┬¡waltung zum NS-Un┬¡rechts┬¡regime: dass sie ver┬¡bre┬¡che┬¡rische Vor┬¡gaben in gewohn┬¡te b├╝ro┬¡kratische Pro┬¡zesse ├╝ber┬¡setzte, die das bie┬¡dere Gesicht des un┬¡partei┬¡ischen und an das Recht ge┬¡bun┬¡de┬¡nen Be┬¡amten trugen.
Ich danke Ihnen f├╝r Ihre M├╝he und Zeit.
Das Inter­view führ­te schriftlich Charlotte Kempf.

